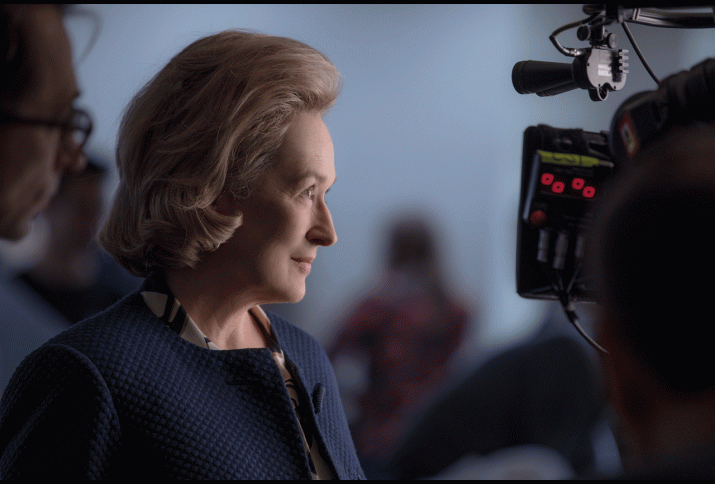Der für zwei Oscars in den Kategorien bester Film sowie mit Meryl Streep als beste Hauptdarstellerin nominierte Spielfilm The Post – Die Verlegerin kommt am 17. April 2018 auf DVD und Blu-ray in englischer Sprache heraus. Der Film von Steven Spielberg kam am 22. Dezember 2017 in die US-amerikanischen Kinos und war ab dem 22. Februar 2018 in den deutschen Kinos zu sehen.
Sie haben es schon wieder getan. Wenn Steven Spielberg Regie und Janusz Kaminski die Kamera führt, wird Geschichte zu großem Kino und so ausgemalt, dass man mitfiebert, obwohl das Ende längst bekannt ist. Der Kniff liegt wohl in der Mischung aus Nähe und Distanz und einer subtilen Überblendung von gestern und heute. Im Hintergrund gibt William Faulkner den Takt vor, weil Spielberg sich das klassische Diktum des großen Schriftstellers zu eigen gemacht hat: „Das Vergangene ist nie tot. Es ist noch nicht einmal vergangen.“[1]
Wer Eindeutiges oder Erbauliches will, wird nur an wenigen Stellen und mit der üblichen Meterware aus Hollywoods Asservatenkammer bedient. Geschenkt. Was den Film stattdessen ausmacht, ist Ambivalentes, Changierendes, nicht zu Ende Erzähltes.
Deshalb ist auch das Etikett „Emanzipationsfilm“ ein Schwindel. Gewiss bietet Katharine Graham (Meryl Streep), die nach dem Selbstmord ihres Mannes buchstäblich von einem Tag auf den anderen die Geschäfte der „Washington Post“ zu verantworten hat, einer Männerwelt voller Hochnäsigkeit, Herablassung und Zudringlichkeit die Stirn – anfänglich tastend, am Ende resolut und erfolgreich. Aber Spielberg insistiert darauf, dass dieser Erfolg noch lange keine Befreiung aus männlicher Vormundschaft ist. Ohne ihren Chefredakteur Ben Bradlee (Tom Hanks) wären Verlegerin und Zeitung nicht zur Legende geworden. Er stößt die Tür auf, durch die sie schließlich geht, er drängt sie mit subtilen Anspielungen dazu, der Familientradition gerecht zu werden und zu tun, was Phil Graham in ihrer Situation vermutlich getan hätte: staatsbürgerliche Verantwortung übernehmen, einer übergriffigen Regierung die Grenzen aufzeigen und durch eine Publikation der streng geheimen „Pentagon Papiere“ die Öffentlichkeit mit der Wahrheit über den Krieg in Vietnam konfrontieren. Die verzückte Huldigung junger Frauen, die vor dem Portal des Obersten Gerichtshofs Spalier stehen und der Verlegerin im Rechtsstreit mit der Regierung Nixon den Rücken stärken wollen, nimmt „Kay“ Graham schüchtern und eher irritiert zur Kenntnis. Sie scheint am besten zu wissen, dass naive Anbetung nicht zu ihr und ihrer Geschichte passt. Wie Meryl Streep mit sparsamer Mimik an dieser Stelle Hollywoods geliebtes Accessoire der Heldenverehrung zur Seite legt, will weiß Gott gelernt sein.
„Wir drucken.“ Mit zwei Worten löst Graham die Spannung in den Redaktionsbüros auf und zeigt ihren opportunistischen, stets nur nach eigenem Vorteil japsenden Hausjuristen, wer Herr im Haus ist. Und doch geht es nur vordergründig um eine Demonstration weiblicher Durchsetzungsfähigkeit. Spielberg inszeniert stattdessen Uneindeutiges, verweigert klare Antworten und lässt offen, was bei nüchterner Betrachtung ohnehin offenbleiben muss: Warum sich die Verlegerin so und nicht anders entschieden hat, wie ihr Entschluss zustande kam, ob sie einer spontanen Eingebung oder reiflicher Überlegung folgte. Klar ist nur, dass sie ein hohes Risiko einging. Hätte die Justiz eine Publikation der „Pentagon Papiere“ untersagt, wäre der anstehende Börsengang und damit die überfällige finanzielle Sanierung des Blattes in Gefahr geraten. Nichts weniger als das Lebenswerk von Generationen stand auf dem Spiel. Sie entschied sich für das höhere Gut – für das Interesse der Allgemeinheit an einer freien Presse und den Schutz der Gesellschaft vor einer ihre Macht missbrauchenden Regierung.
Wohlfeil und damit irreführend wäre der Verweis auf Hollywoods Vorliebe für die Einsamen jeden Geschlechts, die Gefahren ignorieren und auf die Frage nach ihren Motiven ebenso blasiert wie politisch korrekt antworten: „A woman must do, what a woman must do.“ Von wegen, sagt der international renommierte Historiker und Ökonom Gar Alperovitz. Neben dem „Verräter“ Daniel Ellsberg, der die „Pentagon Papiere“ kopiert und der „New York Times“ zugespielt hatte, spielte Alperovitz damals eine entscheidende Rolle im Hintergrund. Ihm war es zu verdanken, dass möglichst viele Redaktionen zeitgleich mit dem brisanten Material beliefert wurden. Wenn der „Times“ der Abdruck verboten würde, so das Kalkül, könnten die „Washington Post“ und der „Boston Globe“ einspringen oder 16 andere Blätter. „Gar hatte all diesen Nacht-und-Nebel-Kram in der Hand.“, sagte Ellsberg jüngst. Warum? Im Grunde wundert sich Alperovitz noch heute über seinen Entschluss. „Eigentlich bin ich eine sehr vorsichtige Person“, ließ er am 29. Januar 2018 den „New Yorker“ wissen. „Aber ich habe keine Sekunde gezögert – was ich noch immer nicht verstehe. Ich wundere mich, dass ich nicht einfach sagte: ‚Uuups, aber morgen hab‘ ich was anderes vor.‘ Es sah mir einfach nicht ähnlich.“[2] Womit wir wieder mitten im Film sind. „Kay“ Graham hätte es für sich nicht besser formulieren können.
Wenn es ein Kriterium guter Filme ist, dass sie öffentliche Debatten anregen und darüber auch Neues zu Tage fördern, dann zählt „Die Verlegerin“ erst recht dazu. Kurz vor der Premiere und sage und schreibe 46 Jahre nach dem Knüller von „New York Times“ und „Washington Post“ traten Alperovitz und andere von Ellsbergs Mitstreitern aus der Deckung. Aber längst nicht alle. Eine Frau aus dem „Lavender Hill Mob“, wie sich die kleine Gruppe in Anlehnung an einen 1951 gedrehten Film über dilettantische Bankräuber genannt hatte, wahrt auf Anraten ihrer Anwälte weiterhin Anonymität – weil sie mit ihrer „Green Card“ juristisch angreifbar ist und im Zweifel ausgewiesen werden kann. Paranoia? Wenn, dann mit guten Gründen, denn der „nationale Sicherheitsstaat“ agiert so wuchtig und erbarmungslos wie eh und je. Damals drohte den Enthüllern von Staatsgeheimnissen eine Verurteilung auf Grundlage des „Espionage Act“ von 1917 und damit lebenslange Haft – Ellsberg wurde bekanntlich nicht in der Sache, sondern nur wegen eines juristischen Verfahrensfehlers freigesprochen. Spätestens nach „9/11“ sollte klar sein, wie Amerikas Sicherheit noch heute von Staats wegen definiert und durchgesetzt wird – im Zweifel durch Feinderklärungen an die Presse, die Opposition, die kritische Öffentlichkeit schlechthin.
Ohne den aktuellen Despoten im Weißen Haus wäre „Die Verlegerin“ entweder nicht gedreht oder vom Publikum weitgehend ignoriert worden. Aber Spielbergs Ausflug in die frühen 1970er Jahre verdeutlicht zugleich, dass Trump nur ein Symptom und eben nicht die Ursache des Problems ist. Edward Snowden, Chelsea Manning und andere „whistleblower“ hatten weniger Glück – vielleicht, weil sich auch der liberale Hoffnungsträger im Weißen Haus, Barack Obama, in Sachen „nationaler Sicherheit“ keine Blöße geben wollte, vielleicht, weil es keine Verleger mehr vom Schlage einer „Kay“ Graham gibt. Oder weil schlicht in Vergessenheit geraten ist, warum der Mut zum Skandal ein Lebenselixier freier Presse und mithin einer robusten Demokratie ist. Dass Steven Spielberg mit seinen Mitteln die Licht- und Schattenseiten des Problems thematisiert, ist weit mehr als großes Kino. Es ist Politik jenseits von Hollywood.
[1] Im Original: „The past is never dead. It’s not even past.“ William Faulkner, Requiem for a Nun, Neuaufl. New York 1975. Akt I, Szene III, S. 80. Im deutschen Sprachraum vor allem bekannt durch Christa Wolfs hier zitierte Übersetzung: Christa Wolf, Kindheitsmuster, Berlin 1976. S. 9.
[2] Gar Alperowitz im Interview mit Eric Lichtblau, The Untold Story of the Pentagon Papers Co-Conspirators, in: The New Yorker vom 29.01.2018.