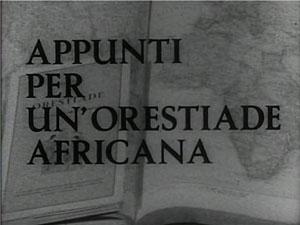1. Einleitung: Krise und Kritik des Eurozentrismus
In den langen 1960er-Jahren[1] unterlag das Verhältnis des euroamerikanischen Raums zur damaligen „Dritten Welt“ einem fundamentalen Wandel. Die Emanzipation der ehemaligen Kolonien machte sich in geopolitischen Umwälzungen ungekannten Ausmaßes bemerkbar. Anstatt sich mit der formalen Unabhängigkeit abspeisen zu lassen, drängten die dabei entstandenen neuen Nationalstaaten auch auf wirtschaftliche und kulturelle Autonomie. Vor diesem Hintergrund fiel es den europäischen Gesellschaften mit einem Mal schwer, sich weiterhin als Ausgangs- und Mittelpunkt des Weltgefüges zu begreifen. In einer radikalen, wenig später aber zumindest in linken Milieus durchaus mehrheitsfähigen Wendung fluchtet Jean-Paul Sartre diese Entwicklung auf eine regelrechte Umkehrung der herrschenden Verhältnisse. In seinem Vorwort zur französischen Erstausgabe von Frantz Fanons „Die Verdammten dieser Erde“ von 1961 schreibt er, übrigens ohne jede Larmoyanz: „Das ist das Ende: Europa ist an allen Ecken leck. Was ist denn geschehen? Ganz einfach dies: bisher waren wir die Subjekte der Geschichte, jetzt sind wir ihre Objekte. Das Kräfteverhältnis hat sich umgekehrt, die Dekolonisation hat begonnen.“[2]
Das westeuropäische Autorenkino jener Epoche – soweit es nicht durch künstlerische Praxen abgelöst bzw. ergänzt wurde, die der situationistischen Kritik an „jeder Spezialisierung, jeder hierarchischen Enteignung“[3] durch eine Hinwendung zu kollektiven Produktionsweisen Rechnung trugen – gibt Zeugnis von diesem folgenreichen Ereignis. Vermehrt widmete es sich dem Außerhalb des euroamerikanischen Raums; manchmal, um es auf den eigenen Standpunkt zurückzubeziehen, manchmal, um diesen zu überwinden.[4]
Auch an dem Romancier, Lyriker, Dramatiker, Maler, Theoretiker, Theater- und Filmregisseur Pier Paolo Pasolini, einem der prominentesten Vertreter, wenn nicht Inbegriff des westeuropäischen Autorenkinos und der ihm korrespondierenden auktorialen Kunstauffassung, ging die angezeigte Wende nicht spurlos vorüber. 1966 diagnostizierte er: „Denn es ist doch allen ganz klar, daß in diesen Jahren die bäuerliche Welt der ganzen Erde – die Dritte Welt – auf die Bühne der Geschichte tritt (mit einem Bein noch in der Vorgeschichte).“[5] Die Parenthese gibt Aufschluss über den speziellen Gesichtspunkt, unter dem sich Pasolini für die Dritte Welt interessierte: Es war die daran geknüpfte Vorstellung einer residualen „Vorgeschichtlichkeit“, die seine Begegnungen mit ihr anleitete. So auch Anfang der 1970er-Jahre, als er sich mit der Idee trug, den mythologischen Stoff von Aischylos’ „Orestie“ nach Afrika zu verlegen. Die Vorarbeit zu diesem Projekt, das jedoch nie realisiert wurde, gestaltete Pasolini zu einem Filmessay mit dem Titel APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA (Italien, 1970) aus, zu deutsch: „Notizen für eine afrikanische Orestie“.[6]
Die vorliegende Arbeit unternimmt den Versuch, Pasolinis politische und ästhetische Praxis am Beispiel von APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA an die zeitgenössische episteme[7] bzw. deren Krise anzubinden und ihren Wechselwirkungen nachzuspüren. Freilich geht es, wenn hier von Wirkungen die Rede ist, nicht um eine einfache Kausalbeziehung, nicht um den Zeitgeist als Ursache einer bestimmten Profilierung von Pasolinis Œuvre, sondern um das Ausloten eines zeit- und ideengeschichtlichen Wirkungszusammenhangs, aus dem Pasolini der Künstler und öffentliche Intellektuelle nur insofern hervorgeht, als er sich (auch) davon abhebt. Vom zeitgeschichtlichen Wirkungszusammenhang, den auszuschildern Aufgabe des zweiten Kapitels sein wird, soll im dritten Kapitel der werkimmanente Kontext unterschieden werden. Denn genauso wenig, wie Pasolinis Werk von seiner Zeitgenossenschaft losgelöst werden kann, ist es darauf reduzibel. Die einigermaßen künstliche Unterscheidung zwischen zeit- bzw. ideengeschichtlichen und werkimmanenten Kontexten dient hierbei dem heuristischen Zweck, Interessen und Motiven bei Pasolini beizukommen, die einer weiter gehenden Erklärung bedürfen, als der Verweis auf die gleichzeitige Krise des eurozentrischen Weltbilds sie zu leisten vermag.
Anschließend sollen Kontexte und ästhetische Praxis anhand einer detaillierten Filmanalyse integriert werden. Das Vorhaben von APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA, auf der Folie eines europäischen Mythos ein Verständnis für die afrikanische Gegenwart (anno 1970) zu erarbeiten, provoziert eine Reihe von Diskrepanzen und Fehlleistungen. Zum gesprochenen Kommentar von APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA, der sich aus dem herrschenden Diskurs der europäischen Linken speist, setzt sich die Bildspur in ein von Widerständen und Unvereinbarkeiten gekennzeichnetes Verhältnis, das an seinem äußersten Pol aufhört, Verhältnis zu sein. Darin gibt sich Pasolinis Projekt als Anmaßung zu erkennen, die mehr über Europas ideelle Investitionen in die Dritte Welt preisgibt, als über ihren vorgeblichen Gegenstand: Weder die politischen und sozialen Realitäten des postkolonialen Afrika, noch die darin vermuteten Rückstände einer vormodernen, ja „vorgeschichtlichen“ Anschauung werden hier verhandelt, sondern das aporetische Verhältnis Europas zu Afrika, worin solche Vorstellungen zu allererst gediehen. Wenn Pasolini das eurozentrische Weltbild an einen kritischen Punkt treibt, so tut er dies anhand der spezifischen Gestaltungsmittel des filmischen Mediums. APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA impliziert daher, wie im Ausblick zu zeigen sein wird, nicht zuletzt auch eine Krise des eurozentrischen Laufbilds.
2. Zeit- und ideengeschichtliche Kontexte: Die Dezentrierung der europäischen Linken
Wie sich in Sartres oben zitiertem Ausspruch schon andeutet, stieß die Krise des eurozentrischen Weltbilds nicht nur jenen übel auf, deren Funktion oder Profit am Fortbestehen kolonialistischer Regime hing. Auch die europäische (und US-amerikanische) Linke musste sich in der neuen Situation erst zurechtfinden. Schon vorher hatten sich Zweifel geregt, ob das als saturiert abgeschriebene westliche Proletariat noch zum revolutionären Subjekt taugte. Entgegen der marxistischen „Verelendungstheorie“[8], wonach die Entwicklung des Kapitalismus zu immer größerer Kapitalkonzentration auf der einen, und einer entsprechend größeren Pauperisierung der lohnabhängigen Massen auf der anderen Seite tendiere, hatte die Arbeiterklasse der europäischen Industrienationen seit den Nachkriegsjahren relativen Wohlstand erlangt.
Vordenker der Neuen Linken zweifelten öffentlich am revolutionären Bewusstsein dieser zusehends in die Konsumgesellschaft eingebundenen Klasse, ja am Begriff der Klasse selbst, und redeten der Suche nach neuen Protagonisten der gesellschaftlichen Veränderung das Wort.[9] In seiner viel gelesen Zeitdiagnose „Der eindimensionale Mensch“ konstatierte Herbert Marcuse, dass der Antagonismus zwischen Bourgeoisie und Proletariat seine Dringlichkeit und mithin die im marxistischen Katechismus vorgesehene Funktion eines geschichtlichen Movens eingebüßt habe: „Die kapitalistische Entwicklung hat jedoch die Struktur und Funktion dieser beiden Klassen derart verändert, daß sie nicht mehr die Träger historischer Umgestaltung zu sein scheinen.“[10]
Mit diesem Verdikt war vor allem der Aufstieg einer Konsumgesellschaft angesprochen, die immer weitere Bevölkerungsschichten – und immer weitere Weltengegenden – ihrer ökonomischen Logik assimilierte, mit der Tendenz, den ganzen Globus zum Innenraum des Kapitals umzugestalten. Viele Kommentatoren der europäischen Linken waren sich einig: Nicht nur das klassische Proletariat sei inzwischen der Konsumgesellschaft eingemeindet und solcherart politisch unschädlich gemacht worden. Auch jene antiautoritären Bewegungen, die sich seit Anfang der 1960er-Jahre im Inneren der kapitalistischen Hegemonialmächte herausgebildet hatten, stünden nicht unbedingt in einem Gegensatz zur Evolution des Kapitalismus. Ihr zur Schau gestellter Hedonismus erschien nicht mehr als Überwindung einer reaktionären, puritanischen Gesinnung, sondern als schleichende Einübung in flexibilisierte Arbeitswelten.[11] Die integrative Kraft des so genannten Systems entwaffnete noch dessen innigsten Gegner, und schlug Kapital daraus.
Die Gültigkeit der Marx’schen Analyse, wonach die Geschichte aller bisherigen Menschheit die Geschichte von Klassenkämpfen sei,[12] war – jedenfalls für den euroamerikanischen Raum – fragwürdig geworden. Widerstand, so spitzte Marcuse die veränderte Situation paradigmatisch zu, sei nur noch von den Ausgeschlossenen und Marginalisierten zu erwarten. Die Neue Linke schloss sich dieser Einschätzung an und investierte fortan große Hoffnungen in die Völker der Dritten Welt, aber auch in die Minoritäten der Metropolen.[13] Sie sollten nicht enttäuscht werden: Die Unabhängigkeit der neuen afrikanischen Nationalstaaten auf dem Territorium des ehemaligen Französisch-Westafrika (1958), die kubanische Revolution (1959), der Befreiungskampf der Algerier/innen (1954-1962), die chinesische „Große Proletarische Kulturrevolution“ (1966-1969), die Tet-Offensive des Vietcong (1968) – unabhängig davon, wie diese sehr verschiedenen Ereignisse heute bewertet werden mögen, führten sie doch alle der metropolitanen Linken vor Augen, dass die Möglichkeit der Revolution sich vom Zentrum an die Peripherie verlagert hatte.
Dies warf die Frage auf, ob die dabei erprobten Strategien auf europäische Verhältnisse umgelegt, die Möglichkeit der Revolution importiert werden könne.[14] Ernesto „Che“ Guevaras Theorien der Guerilla und des foco[15] boten sich z. B. als Legitimation voluntaristischer Vorstöße gegen das staatliche Gewaltmonopol an.[16] Aber auch diejenigen, welche die Frage nach der Übertragbarkeit revolutionärer Praxis negativ beschieden, blieben von den Entwicklungen in Lateinamerika, Afrika und Asien nicht unbeeindruckt. Der Befreiungskrieg in Algerien war ein entscheidendes Ereignis in der politischen Sozialisation zahlreicher späterer Aktivisten und Aktivistinnen des Pariser Mai 1968,[17] und insbesondere Vietnam geriet als Fanal westlicher Weltherrschaft zur vielleicht bedeutendsten Bezugsgröße der europäischen Linken.[18] Infolge wurden zahlreiche Theoretiker aus der Dritten Welt zunehmend auch in Europa rezipiert, oft vermittelt durch antikolonialistisch gesinnte westliche Intellektuelle: Fanon via Sartre, Guevara via Régis Debray, Aimée Cesaire via André Breton und viele mehr.
Dieser Zufluss außereuropäischen Denkens trieb das europäische zu einer profunden Selbstkritik, deren Nachwirkungen noch heute allgegenwärtig sind. Das teleologische Geschichtsmodell des Marxismus, demzufolge bürgerliche Revolution und kapitalintensive Industrialisierung dem ersehnten Ausbruch aus dem Reich der Notwendigkeit als unerlässliche Vorbedingungen vorauszugehen hätten, war mit dem Gelingen revolutionärer Umstürze in der agrarisch geprägten Dritten Welt nicht vereinbar. Dass an dem Modell etwas faul sein musste, hatte schon seine Anwendung in der stalinistischen Sowjetunion gezeigt: Noch ein Kernbestand marxistischer Theorie, der an der Gegenwart versagte. Aber nicht nur die marxistische Abwandlung dieses im Kern Hegelianischen Geschichtsmodells stand unter deutlichem Legitimationsdruck. Auch andere europäischstämmige Grands récits[19] waren davon betroffen, allen voran die Erfolgsgeschichte des weißen Mannes, dessen geistige, materielle und technologische Entwickeltheit ihn gegenüber den als unterentwickelt vorgestellten Anderen als Herrn ausweisen sollte.
Claude Lévi-Strauss’ Anthropologie, die mit der vorherrschenden Auffassung des Primitiven in mehrerlei Hinsicht aufräumte, kam hierbei eine leitende Rolle zu. Er stellte fest, dass diejenigen Völker oder Stammesgemeinschaften, „die wir ‚Primitive’ nennen“[20], über der modernen Wissenschaft analoge Verfahren und Methoden der Produktion von Wissen verfügten; dass ihr Wirklichkeitsbezug überdies nicht, wie häufig unterstellt, vornehmlich auf die Befriedigung von Bedürfnissen ausgerichtet, sondern ebenso reflexiv sei wie jener abendländischer Wissenschaftler. Die Herablassung, mit der etwa westliche Schulmediziner auf indigene Heilverfahren, deren Wirksamkeit ihnen zweifelhaft erscheint, blicken, gründet demnach auf falschen Voraussetzungen. Ihre Kritik zielt einzig auf den praktischen Aspekt des Verfahrens, übersieht aber den theoretischen, das Regelwerk, auf das die betreffende Praxis abhebt. Wenn ein indigener Medizinmann meint, die Berührung mit einem Spechtschnabel sei ein adäquates Mittel gegen Zahnschmerzen, tue sich hinter dieser Meinung der „Anfang einer Ordnung im Universum“[21] auf. Hierin ähnelt die Meinung des Medizinmanns jener des Schulmediziners, und insofern hält es Lévi-Strauss für gerechtfertigt, das primitive Denken als „Grundlage jedes Denkens“,[22] mithin auch des neuzeitlich naturwissenschaftlichen, zu benennen. Anstatt das primitive Denken als Vorstufe eines entwickelteren Stadiums des menschlichen Geistes aufzufassen, unterscheidet Lévi-Strauss zwei koexistierende und aufeinander angewiesene Ebenen der Erkenntnis, die Sphäre der Wahrnehmung und der Einbildungskraft auf der einen und die Sphäre der Abstraktion auf der anderen Seite.[23]
Mit der Vorstellung, der europäische Mensch sei so etwas wie die Fortentwicklung und Vollendung eines primitiven Ursprungs, entsorgte Lévi-Strauss’ Anthropologie eine grundlegende Legitimationsfigur kolonialer Herrschaft: Die Überlegenheit der „weißen Rasse“. Dennoch, so warnt Lévi Strauss, sei das primitive Denken in einer Gesellschaft, die sich der instrumentellen Vernunft verschrieben hat, von der Ausrottung bedroht. Ihr letztes Residuum erblickte er in der Kunst; eine Vorstellung, der im Folgenden noch einige Bedeutung zukommen wird.
Des Weiteren erneuerten Lévi-Strauss’ strukturale – oder, wie es später heißen sollte: „strukturalistischen“ – Mythenanalysen das Interesse am Zusammenhang zwischen kulturellen Phänomenen der Gegenwart und solchen, die Jahrhunderte, mitunter Jahrtausende zurücklagen. Auch hier trat an die Stelle des ausgedienten teleologischen Modells menschlicher Entwicklung die Vorstellung, dass bestimmten Strukturen eine bald anthropologische Konstanz eigne, die sich durch alle Zeiten, vorgeschichtliche wie geschichtliche, zieht und die überlegene Zivilisiertheit des westlichen Menschen Lügen straft. So wurden unter dem Eindruck von Lévi-Strauss’ Theorien auch zeitgenössische Artefakte als mythische oder mythenförmige Gebilde lesbar, deren Verhältnis zu den Gesellschaften, aus denen sie hervorgegangen waren, verschiedentlich als imaginäre Kompensationsleistung oder ritualisierte Lösung gesellschaftlicher Widersprüche beschrieben wurde, z. B. mit Bezug auf die generischen Musterbildungen des klassischen Hollywoodkinos.[24]
Zum Abschluss dieser abrisshaften zeit- und ideengeschichtlichen Situierung sei noch ein innerhalb der europäischen Linken viel diskutiertes Thema angedeutet, das zwar nur mittelbar mit der simultanen Krise des Eurozentrismus zu tun hat, im Folgenden aber eine entscheidende Rolle spielen wird: die Kritik der Repräsentation.[25]
Die Neue Linke begriff sich lange Zeit als außerparlamentarische Opposition, ihr Angriffsziel war die parlamentarische Demokratie, insbesondere das ihr eigene System politischer Stellvertretung als nahtlose Fortsetzung der allgemeinen gesellschaftlichen Arbeitsteilung, worin die hoch spezialisierte Facharbeiterkaste der Politiker das Geschäft der Gemeinschaft besorgt. So wie ihr Gegenstand erstreckte sich die Kritik an dieser Organisationsform des Politischen über die Institutionen des demokratisch legitimierten Parlamentarismus hinaus bis in die Sphäre der Kunstproduktion. Wer politische Kunst auf der Höhe der Kritik machen wollte, konnte sich nicht länger bedenkenlos zum Fürsprecher der Gesellschaft oder eines ihrer Konstituentien aufschwingen. Infolge bedrängten partizipative Modelle der Repräsentation auch im Bereich der Kunst die vormals hegemoniale Logik der Stellvertretung oder, mit einer Wendung Guy Debords, der „Trennung“.[26] In seinem viel gelesenen Traktat zur „Gesellschaft des Spektakels“ von 1967 klagte Debord die vielfältigen Ausprägungen dieses Macht erhaltenden Prinzips scharf an – die Trennung des Arbeiters von seinem Produkt, der Gesellschaft von ihrer politischen Repräsentanz, der Welt von ihrem fetischisierten Abbild.[27] Im Begriff des Spektakels hypostasierte Debord das Bild zur leitenden Instanz der Trennung und schuf so das Paradigma einer kritischen Bildtheorie, die das Kunstverständnis der Achtundsechziger nachdrücklich prägen sollte. Ins Kreuzfeuer ihrer Kritik gerieten insbesondere die Tradition der auktorialen Werkkunst und – qua Extension – das zumindest mit einem Bein in dieser Tradition stehende europäische Autorenkino der langen 1960er-Jahre, dem auch Pasolini angehörte.
3. Werkimmanente Kontexte: Wider die „bürgerliche Entropie“
Wie verhielt sich Pasolini in seinen Filmen, aber auch in seinen zahlreichen schriftlichen Äußerungen, worin er sich an den zeitgenössischen politischen Debatten beteiligte, zur angezeigten geopolitischen und geistesgeschichtlichen Wende? Inwiefern ist sein Schaffen jener Epoche verpflichtet? In welchem Maß hebt es sich dennoch davon ab? Welche allgemeinen und welche besonderen Interessen trieben Pasolinis Auseinandersetzung mit der Dritten Welt an?
Den Ausgangspunkt für die nachstehende Erörterung dieser Fragen bildet Pasolinis Herkunftsland Italien. Für die italienische Halbinsel gilt, was im zweiten Kapitel über die Gesamtentwicklung Europas gesagt wurde: In den 1950er-Jahren hatte das Land einen ungeheuren Industrialisierungsschub erfahren, proletarische Schichten drängten zunehmend auf eine Beteiligung an der Konsumgesellschaft.[28] Die PCI, die kommunistische Partei Italiens, war ihrerseits seit Ende des 2. Weltkriegs an der Regierung beteiligt und vertrat eine reformistische Auffassung politischer Gestaltung; nichts lag den arrivierten Kommunist/innen ferner, als, gemeinsam mit der Neuen Linken Italiens, die viel beschworene „Systemfrage“ zu stellen.[29]
Wie so viele linke Intellektuelle Westeuropas, die sich nach der Niederschlagung des ungarischen Volksaufstands (1956) und dem jähen Ende des Prager Frühlings (1968) von der Sowjetunion abgewandt hatten, hielt auch Pasolini das stalinistische Regime für keine Alternative. Dessen hehre Ziele seien im Keim erstickt, weil die Etappe des bürokratischen Zentralismus nie zugunsten einer dezentral organisierten, partizipativen Volksdemokratie überwunden worden war, kurz: weil „die Revolution nicht weitergegangen ist“.[30] Was blieb, nachdem die großen Systementwürfe der ersten und zweiten Welt bestenfalls in Apathie und schlimmstenfalls in Terror und Unterdrückung gemündet waren? Die oben nachgezeichnete Transformation der kapitalistischen und realsozialistischen Welten, aus der die europäische Linke jene Lehren zog, die eine grundlegende Revision ihrer bisherigen Politik, ja ihres bisherigen Verständnis davon, was Politik überhaupt sei, notwendig machen sollte, ging auch an Pasolini nicht unbemerkt vorüber. In vielen Fällen zog er daraus ähnliche Schlüsse. Vor allem aber die charakteristische Suchbewegung, die vom Abgesang des Proletariats ihren Ausgang nahm, und dann über die Peripherie der eigenen Gesellschaft bis an das Andere der westlichen Welt heranführte, findet sich – zuzüglich einiger idiosynkratischer Momente – auch bei Pasolini wieder.
Seine Suche nach neuen Subjekten eines gesellschaftlichen Umsturzes führte ihn erst an die Grenzen Roms, in die Vorstädte von ACCATONE (Italien, 1961) und dem dort ansässigen Subproletariat. Nach dessen vermeintlicher Absorption durch die von Pasolini so bezeichnete „bürgerliche Entropie“[31] – die totale Nivellierung jeglicher sozialen Spezifik im Zeichen des universellen Konsumismus – wandte er sich der mythischen Vorzeit seiner MEDEA und seines EDIPO RE (Italien, 1967), und von dort aus den Massen der Dritten Welt zu. Was wie ein Umweg anmutet, war in Pasolinis Augen gar keiner. In einem Gespräch, das Jean Duflot 1970 mit ihm führte, wies Pasolini die Barbarin Medea als allegorisches Opfer des neuzeitlichen Kolonialismus aus: „Wenn Sie wollen, könnte es ebenso gut die Geschichte eines Volks der Dritten Welt sein, eines afrikanischen Volks zum Beispiel, das die gleiche Katastrophe im Kontakt mit der materialistischen westlichen Zivilisation erlebte.“[32] Das Film-Kolchis gibt sich denn auch ganz unverstellt als Amalgamierung der Dritten Welt zu erkennen: Auf der Tonspur montiert Pasolini tibetanische und afrikanische „Kultmusiken“[33], Drehort waren die kappadokischen Felsenkirchen der Osttürkei und Wüstenstädte Syriens. Medeas Geliebter und Widerpart Jason dagegen legt die Allüre eines hedonistischen Popstars an den Tag, was Peter W. Jansen und Wolfram Schütte zu der Äußerung veranlasste, Pasolini inszeniere ihn als Achtundsechziger, dessen rebellisches Auftreten zur leeren Pose verkommen ist.[34]
In dieser Einschätzung traf sich Pasolini mit Marcuse, den er nicht allein darum mit Begeisterung las. Auch im Hinblick auf die „Mythisierung“ der Dritten Welt empfand der italienische Filmemacher den deutschen Philosophen als Bruder im Geiste; eine Ehrbezeigung, die Pasolini auch auf Fanon und Lévi-Strauss ausdehnte.[35] Was alle diese Mythisierungen gemein haben und in dieser gemeinsamen Eigenschaft für Pasolini so reizvoll machte, ist die in ihnen beschlossene Kritik am unerschütterlichen westlichen Fortschrittsglauben, den nicht nur Pasolini für eine Erblast der Hegelianischen Geschichtsphilosophie hielt. Seine eigene Mythisierung der Naturvölker hatte denn auch eine entschieden antihegelianische Schlagseite: „Hegel! Sade! Le mythe! Eh oui! quand je parle de nature, il faut toujours entendre ‚mythe de la nature‘: mythe antihégélien et antidialectique parce que la nature ne connaît pas les ‚dépassements‘; tout s‘y juxtapose et coexiste […].”[36]
Aber noch in einer anderen Hinsicht war Pasolini ein Kind seiner Zeit, der Zeit einer weit reichenden Krise des eurozentrischen Weltbilds. Wie ging Pasolini in dem Moment, da er sich den Völkern der Dritten Welt zuwandte, mit dem Problem der Stellvertretung um? Vielleicht mit Bewunderung, jedenfalls staunend teilte er seine Beobachtung mit, dass Tausende von Studenten (etwa der gleiche Prozentsatz der Bevölkerung, den die Partisanen im Europa der vierziger Jahre ausgemacht hatten) in die Südstaaten gehen, um im Schwarzen Gürtel Amerikas an der Seite der Farbigen zu kämpfen – mit dem leidenschaftlichen und fast mystisch demokratischen Bewusstsein, ‚sie nicht zu manipulieren’, auch nicht mit sanftem Zwang auf sie einzuwirken und, beinahe neurotisch, für sich selbst auch nicht die Spur irgendeiner Form von ‚leadership’ zu beanspruchen.[37]
In dieser Formulierung klingt eine Schwierigkeit an, die Pasolinis filmisches Schaffen seit seinem Erstlingswerk ACCATONE umtrieb, und die es seit ebenso langer Zeit auf verschiedene Weise konfrontierte: Die Kluft zwischen einem Autorensubjekt, das unter Umständen nicht einmal den Status eines organischen Intellektuellen im Sinne Antonio Gramscis[38] beanspruchen konnte, und jenem anderen Subjekt vulgo sujet, das es zu repräsentieren gilt. Eine Schwierigkeit, die dadurch noch verschärft wurde, dass es sich beim angestrebten Subjekt nicht um eine einzelne Person, nicht um das bürgerliche Individuum handelte, sondern um ein Kollektiv, eine Vielheit, womöglich ein Volk. So beschreibt Bernhard Groß den „Zusammenhang von Pasolinis ästhetischem Projekt [...] als Suche nach einem nicht hierarchisch organisierten kollektiven Ausdruck. Das meint in bezug [sic!] auf eine geschichtliche Utopie die Unmöglichkeit einer auktorialen Position [...].“[39] Der Begriff des kollektiven Ausdrucks findet sich in einem ähnlichen Sinn bei Gilles Deleuze, wo er ein Potenzial jener vielfältigen filmischen und parafilmischen Praxen des so genannten Dritten Kinos[40] bezeichnet, die in den langen 1960er-Jahren in großer Nähe zu den Befreiungskämpfen in der Dritten Welt entstanden.[41] Wie aber konnte ein westlicher Regisseur die Dritte Welt ausdrücken, ohne in den diskreditierten Modus der Repräsentation zu verfallen? Einen möglichen Schlüssel zu diesem Problem stellt Pasolinis Auffassung und Abwandlung des aus der Literaturtheorie stammenden Begriffs der freien indirekten Rede dar. Mit Blick auf seine literarische Arbeit definierte er die freie indirekte Rede folgendermaßen:
Sie ist ganz einfach das Eintauchen des Autors in die Seele seiner Figur und daher von Seiten des Autors die Annahme nicht nur der Psychologie seiner Figur, sondern auch ihrer Sprache.[42]
An anderer Stelle sprach Pasolini in diesem Zusammenhang auch von „erlebter Rede“[43]: Im sprachlichen Nachvollzug des Erleben seiner Figuren verwischt Pasolini die Grenze zwischen Erzähler und Erzählten. In seinen Romanen findet dieses Verfahren als Aneignung vielfältiger Dialekte und Rhetoriken sowie als resultierender Pluralismus der Sprecherpositionen Niederschlag. Eine Übertragung der freien indirekten Rede auf das Medium Film, so bemerkte Pasolini einmal, müsste bei der visuellen Wahrnehmung einer Figur ansetzen, oder vielmehr: diese assimilieren. Den dabei entstehenden Bildtypus taufte er, etwas umständlich, „indirekte freie subjektive Perspektive“.[44] Dabei schwebte ihm jedoch nicht einfach die vereinzelte filmische Subjektive vor Augen – denn diese, wollte man die literaturtheoretische Analogie aufrecht erhalten, entspräche viel eher der direkten Rede[45] –, sondern eine umfassende Subjektivierung des gesamten Films, die, in diametralem Gegensatz zur herkömmlichen Subjektive, die Autorschaft des Blicks nicht klärt, sondern verundeutlicht: „[I]n cinema, the indirection of discourse poses the crucial question of who is seeing?“[46]
Anstatt den Begriff der indirekten freien subjektiven Perspektive näher zu erläutern, verwies Pasolini auf deren eurozentrische Schwundform, die er im europäischen Autorenkino der langen 1960er-Jahre vorfand. Im perzeptorischen Prisma der neurotischen Protagonisten bei Michelangelo Antonioni, Bernardo Bertolucci oder Jean-Luc Godard breche sich lediglich deren eigene, neurotische Weltsicht. Insofern das Publikum die Frage „Who is seeing?“ nicht länger zugunsten von Autor oder Figur entscheiden konnte, brachten sie das Verfahren erfolgreich in Anschlag. Insofern die derart vermengten Subjektivierungen aber mehr oder weniger austauschbar waren, vergeudeten sie das für Pasolini entscheidende Potenzial:
Wie die Bourgeoisie objektiv zu betrachten war, das zeigte uns, nach einem typischen Muster, jener ‚Blick’, den die nichtbürgerliche Welt auf sie richtete: die Arbeiter und die Bauern (der, wie sie später heißen sollte, Dritten Welt). Deshalb konnten wir, die jungen Intellektuellen vor zwei oder drei Jahrzehnten [...] antibourgeois auch außerhalb der Bourgeoisie sein: vermöge der Optik, die uns von den anderen (gleichviel, ob revolutionären oder revoltierenden) gesellschaftlichen Klassen geboten wurde.[47]
Der einzige Ausweg aus der bürgerlichen Entropie bestand für Pasolini in der Annahme der „Optik“ ihres Außerhalb. Welches Mittel wäre dafür angemessener als die freie indirekte subjektive Perspektive? Man darf sich indes von der visuellen Metapher nicht in die Irre führen lassen. Denn das Gegenstück zur bürgerlichen Weltsicht, die Pasolini im Anschluss an Marcuse und Lévi-Strauss als von einer abstrakten und zweckmäßigen Rationalität durchherrscht ansah, konnte unmöglich wiederum nur „optisch“ verfasst sein, sondern sollte einen ganzheitlichen, i. e., sinnlich ungetrennten Weltbezug restituieren. Wie Pasolini die Wiederherstellung einer solchen Sinnlichkeit erreichen wollte, deutet sich in der folgenden Äußerung an:
"Freilich: um zu einem nicht bloß formaldemokratischen Bewußtsein von sich und der Gesellschaft zu gelangen, hat der wahrhaft freie Amerikaner durch das Leiden der Neger [sic!] hindurchgehen und es teilen müssen (so wie er jetzt durch das Leiden Vietnams hindurchgehen muß)."[48]
Zwar führt Pasolini an dieser Stelle nicht aus, wie dieses Hindurchgehen, diese Passage durch das Leiden der Anderen vonstatten ging, und es liegt nahe, sie unter psychologischen Vorzeichen als Identifikation mit den Ausgestoßenen und Marginalisierten auszudeuten. Vor dem ideengeschichtlichen Hintergrund erscheint es jedoch reizvoller, Pasolinis Rede von der Teilhabe am Leiden ästhetisch zu wenden, mehr noch: sie als versuchsweise ästhetisches Programm seiner Beschäftigung mit der Dritten Welt zu setzen. In seinen Filmen über Afrika ging es ihm folglich nicht so sehr darum, seinen europäischen Adressaten etwas zu verstehen zu geben, als sie an einer Sinnlichkeit teilhaben zu lassen, die nach Pasolinis Dafürhalten nicht (mehr) die ihre war.
Bei aller Begeisterung für die Dritte Welt stand sie für Pasolini doch im Begriff, der bürgerlichen Entropie eingestülpt zu werden: „Denn die Bourgeoisie befindet sich auf dem Siegeszug, sie ist dabei, auf der einen Seite die Arbeiter und auf der anderen die Bauern der einstigen Kolonien zu Bürgern zu machen.“[49] Sein Vorhaben einer sinnlichen Teilhabe sah er durch diese Entwicklung eminent gefährdet. Nicht zuletzt deswegen kamen Pasolini in APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA Zweifel an seinem eigenen Programm einer politischen Ästhetik. Die unhierarchische Verschränkung des Autorensubjekts mit den Subjekten seiner Erzählung, die eine sinnliche Teilhabe des Anderen ermöglichen soll, läuft allenthalben ins Leere. Ihr Scheitern gibt den Blick auf all jene eurozentrischen Stereotypen frei, die Pasolinis Zugriff auf den afrikanischen Kontinent informieren. Anstatt sich geschlagen zu geben, nimmt Pasolini das Misslingen seines Projekts als selbstkritische Denkbewegung in den filmischen Essay auf, bei dem es sich darum um einen Versuch im vollen Wortsinn handelt: unsicher, vorläufig, suchend.
4. Filmanalyse: APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA
APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA gibt sich als Skizze eines in Planung befindlichen Filmprojekts – einer, wie der Titel verheißt, „afrikanischen Orestie“ –, handelt indes aber auch und vor allem von den Gründen für das nachmalige Scheitern dieses Vorhabens: Ein filmischer Versuch über die Schwierigkeit Europas, der sozialen Realität Afrikas beizukommen. Ausgehend von der These, wonach die politische Entwicklung in den jungen, seit bald zwei Dekaden zumindest nominell unabhängigen afrikanischen Nationalstaaten Parallelen zu Aischylos’ antiker Dramentrilogie aufweise, will Pasolini Personal und Handlung der Orestie von der mythischen Wiege Europas auf den afrikanischen Kontinent verlagern.
Er begibt sich auf die Suche nach geeigneten Darstellern und Drehorten und gibt aus dem Off Auskunft über die Beweggründe und Zielsetzungen des Projekts. Eine Szene, Orests Wache am Grab seines Vaters, gestaltet Pasolini nach eigenem Bekunden so, wie sie im fertigen Film aussehen soll. Kurz vor dem Ende von APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA löst vorgefundenes Material Pasolinis eigene Aufnahmen ab; Laufbilder vom Biafra-Krieg, die Pasolini – genauso wie jene Bilder, deren Herstellung er selbst beigewohnt hat – allein im Hinblick auf eine mögliche Verwendung in seiner afrikanischen Orestie befragt. Am Ende stehen Aufnahmen zweier Rituale, einer Hochzeit und eines Tanzes. Auch sie deutet Pasolini vor dem Hintergrund der Orestie als Sinnbilder sowohl für die geglückte Verwandlung der Erynnien in Eumeniden, als auch für den unwiederbringlichen Verlust, den diese Verwandlung nach sich zieht.
Zuvor durchbricht Pasolini an drei Stellen den Fluss seines filmischen Essays: Nach dem ersten und nach dem zweiten Drittel der Spiellänge, um in einer Art unmöglichen Gegenschuss’ auf den Vorführraum ein bestimmtes Zuschauersegment in den Blick zu rücken: Afrikanische Studenten in Rom, die ihre Meinungen zum eben Gesehenen und dem zugrunde liegenden Bauplan abgeben; und etwa ab der Hälfte des Films, wenn die Kamera sich zu einer Gruppe von Jazzmusikern gesellt, die in einem Kellerlokal aufspielen. Gegeben wird ein szenisches Kondensat der Orestie, mit Saxophon, Schlagzeug und Bassgitarre instrumentiert und von zwei Singstimmen, Agamemnons und Elektras, getragen.
Die oben stehende Inhaltsangabe mag den Eindruck erwecken, Pasolini ordne alles Material der erklärten Absicht unter, die soziale Realität Afrikas mit dem mythischen Griechenland Aischylos’ zu parallelisieren, jene aus diesem abzuleiten und zu erklären. Die folgende Analyse von APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA wird erhellen, wie Pasolini sein eigenes Vorhaben systematisch konterkariert. Sie erfolgt in zwei Schritten. Auf ein ausgiebiges close reading der ersten beiden Einstellungen folgt ein hurtiger Parcours durch den verbleibenden Film, in dessen Verlauf Schlaglichter auf einzelne, besonders signifikante Sequenzen fallen werden.
4.1. Close-Up auf zwei Einstellungen
Der Titelsequenz ist die Fotografie eines aufgeschlagenen Atlas unterlegt, dessen rechte Hälfte eine kartografische Projektion des afrikanischen Kontinents einnimmt. Die linke Seite ist zum größten Teil von einem kleinen Büchlein bedeckt, es handelt sich um eine italienische Ausgabe von Aischylos’ Orestie (siehe Abb. 1).
Es folgt eine Einstellung, deren Gegenstand zunächst nur mit Mühe auszumachen ist. Die unscharfe Form eines Gesichts tritt als eingedunkelter Fleck aus ihrer ebenso unscharfen Umgebung hervor (siehe Abb. 2).
Vor und hinter dem Fleck, dessen unteres Drittel merkwürdig aufgehellt ist, wischen diffuse Schemen vorüber. Augenblicke später setzt eine ortlose männliche Stimme ein und bedeutet, in der Art einer Bildunterschrift, was zu sehen ist: „Mi sto specchiando con la macchina da presa nella vetrina del negozio di una città africana.“[50]
Erst diese Stimme verleiht dem diffusen Formenspiel einen Sinn und eine Richtung: Der Kameramann Pasolini steht vor einem Schaufenster und filmt sein Spiegelbild. Die vorbei huschenden dunklen Schemen gerinnen zu Passanten, andere Unregelmäßigkeiten wie die Aufhellung der unteren Gesichtshälfte werden als optische Effekte der Spiegelung erkennbar. Der zweite Satz, „Sono venuto evidentemente a girare, ma a girare che cosa?“,[51] überlappt den Schnitt zur nächsten Einstellung: Immer noch nimmt die frontal eingefasste Oberfläche des Schaufensters den ganzen Bildkader in Beschlag, nur hat sich die Kamera in der Zwischenzeit ein Stück weit davon entfernt, wodurch die Figuren Pasolinis in der Mitte und seiner Mitarbeiter zur Linken und Rechten sich nun als menschliche Gestalten abheben, inmitten eines von parkenden und kreuzenden Autos sowie Betonbauten gesäumten Straßenzugs (siehe Abb. 3).
An dieser Stelle ertönt die Antwort auf die eben gestellte Frage: „Non un documentario, non un film, sono venuto a girare degli appunti per un film.“[52] Hinter dem Glas sind allerlei Gerätschaften zu erkennen, es könnte sich um Kameras oder andere optische Apparate handeln. Noch bevor sich die Gelegenheit ergibt, sie einwandfrei zu identifizieren, schwenkt Pasolinis Kamera und mit ihr das Bild nach rechts oben; eine Bewegung, in deren Verlauf die Spiegelung der Aufnahmeapparaturen vor und hinter der Vitrine in dem Maß an den Rand des Kaders gedrängt werden, wie jene einer wogenden Baumkrone darin an Raum gewinnt (siehe Abb. 4).
Dazu die ortlose Stimme des Autors: „Questo film sarebbe l’Orestiade di Eschilo, da girarsi nell’Africa di oggi, nell’Africa moderna.“[53]
Bereits von diesen ersten beiden Einstellungen lässt sich eine Anzahl Verfahren abschauen, die Thema und Aporie von APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA exponieren. So kann die Bewegung vom Spiegelreflex des europäischen Filmemachers über das Interieur eines technologisch hoch gerüsteten afrikanischen Geschäfts hin zum Bild des vom Wind gebeutelten Baumwipfels als bildliches abstract der im Folgenden ausgebreiteten Argumentation verstanden werden: Das Interesse an Afrika, das Pasolini mit einer Reihe europäischer Intellektueller der 1960er-Jahre teilt, besteht als spezifisch europäisches darin, die kapitalistische Innenwelt der bürgerlichen Entropie mit ihrem Außerhalb zu konfrontieren und von dort aus kritisierbar zu machen, mit anderen Worten: sich im Spiegel Afrikas selbst zu erkennen.
Mit dem Schnitt zur zweiten Einstellung lässt das Bild diese kritische Standortbestimmung zwar nicht hinter sich, aber es erweitert ihren allzu selbstbezüglichen Umkreis auf die zeitgenössische Gegenwart einer noch namenlosen afrikanischen Stadt. Die Öffnung vollzieht sich im Wechsel der Einstellungsgröße von nah zu halbnah, der eine durch Spiegeleffekte potenzierte Überfrachtung des Bildraums korrespondiert. Die Gegenwart der afrikanischen Stadt offenbart sich in dieser wimmelnden Anordnung als ein Zustand unübersichtlicher Modernisierung. Anstatt die dichte Komposition von Tauschwerten mit Bildern zu kontern, die das Elend der afrikanischen Massen als deren Kehrseite herausstellten, verweilt Pasolini hier noch beim reinen, unanalysierten Phänomen des postkolonialen Status quo. Eine Eröffnung, die jener von Marx’ Kritik der politischen Ökonomie ähnelt. Auch hier macht eine Beschreibung auf phänomenaler Ebene den Anfang: „Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ‚ungeheure Warensammlung’ [...].“[54] (Kursivsetzung N.P.). Dass sich hinter der Feststellung, der Reichtum erscheine so oder so, der Auftrag verbirgt, dieser Erscheinung durch eine Art Tiefen- oder Strukturanalyse beizukommen, versteht sich von selbst. So beeilt sich Marx schon im nächsten Halbsatz, der „die einzelne Ware als seine [des Reichtums] Elementarform“[55] qualifiziert, vom Phänomen zur Analyse überzuleiten. Der Rest ist, mit Verlaub, Geschichte.
Die zweite Einstellung von APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA erfüllt eine dem ersten Satz des „Kapital“ analoge Rolle. Und so nimmt es nicht Wunder, wenn das einmal fixierte Wimmelbild des modernen Afrika im nächsten Moment wieder in Bewegung gerät: Am Ende eines kurzen Schwenks, in dessen Verlauf das Spiegelbild Pasolinis und die Warenwelt hinter dem Spiegel ins Off gewichen sind, spannt der vergleichsweise einfach zu erfassende Anblick eines majestätischen Baumes einen Bogen zum vormodernen, archaischen Afrika der Stammesgesellschaften. Obgleich auch der Baum lediglich als Spiegelung auf der Oberfläche des Schaufensters ins Bild tritt und die urbane Umgebung nicht gänzlich daraus getilgt ist, verleihen ihm die Zielstrebigkeit der vorhergehenden Kamerabewegung und die (gegenüber der ersten) längere Dauer der zweiten Kadrierung eine merkwürdige Emphase: Das Gravitationszentrum von Pasolinis Afrika ist jene residuale Vorgeschichtlichkeit, worin die Dritte Welt nach seinem Dafürhalten noch mit einem Bein steht.
In einem zweiten Durchgang soll die Exposition von APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA unter einem anderen Gesichtspunkt zergliedert werden, dem im weiteren Verlauf ein immer größeres Gewicht zufallen wird. Die Rede ist vom Verhältnis zwischen Bild und Ton. Von Anbeginn ist Pasolinis Stimme jedweder atmosphärischen Verunreinigung entledigt. In den ersten beiden Einstellungen spricht sie zudem von einer Warte, die nicht einwandfrei zugeordnet werden kann: Pasolinis filmisches Abbild ist zunächst unscharf und verwackelt, was ihre augenblickliche Auffassung erschwert, der kurz darauf einsetzende Klang seiner Stimme dagegen ist konturiert und deutlich. Die erste Äußerung gibt im Bild etwas zu erkennen, das darin zwar enthalten war, sich dem Verstehen aber einstweilen widersetzt hatte. Sobald die Stimme sich zum Bild gesellt, gerinnt der verschwommene Fleck zum Gesicht jenes Ich, das der Sprecher für sich beansprucht, und verankert es an einem allgemeinen, typischen Ort, der anderen Orten dieser Art wohl gleichen muss: in einer afrikanischen Stadt.
Wie lässt sich dieses besondere Verhältnis der Stimme zum Bild beschreiben? Michel Chion nennt „akusmatisch“ eine Stimme, deren Ursprung unsichtbar bleibt; die auf den Bildraum oder die Diegese Bezug nimmt, ohne darin verortet werden zu können.[56] Das kann die Stimme einer innerdiegetischen Figur sein, die sich dem Bildraum entzieht, um sich ihm als unsichtbare, akustische Präsenz einzuschreiben; oder eine Erzählstimme, deren Träger nicht der Erzählwelt angehört, und dennoch über äußerliche Vorgänge, manches Mal sogar über die inneren Zustände dieser oder jener Figur, erstaunlich gut unterrichtet ist. Dies wirft die unheimliche Frage auf, woher der Wissensvorsprung der akusmatischen Stimme rührt und evoziert Konnotationen von Allmacht und Allgegenwart.
Auch dem Dokumentarfilm ist die Kraft des Akusmatischen nicht fremd, nur pflegt er in seiner konventionellen Ausprägung einen im doppelten Wortsinn heimlicheren Umgang mit ihr. Die Autorität des körper- und ortlosen Sprechers hat nichts Unheimliches mehr, da sie auf einer außerfilmischen Referenz ruht; auf einem Wissen, das in Büchern oder anderen Speichermedien und Zeugnissen abgelegt sein mag, jedenfalls aber eine von der filmischen Bearbeitung unabhängige Existenz voraussetzt.[57] Zur Legitimation seines epistemischen Privilegs beruft sich der Sprecher – meist stillschweigend – darauf, dass er eine autoritative Quelle zum fraglichen Thema konsultiert oder eigene Beobachtungen dazu angestellt hat. In manchen Fällen mag ein Sprecher „Ich“ sagen, um den Wahrheitsanspruch seiner Rede mit Hinweis auf seine unhintergehbare Subjektivität zu relativieren oder ganz aufzugeben. Aber auch diese vermeintlich kritische Geste hebt, eben indem sie sich im Abstand dazu definiert, auf die legitimatorische Norm der außerfilmischen Referenz ab.
Auch Pasolini sagt „Ich“, doch bezeichnet dieses Ich nicht die Unmittelbarkeit subjektiver Erfahrung in Abgrenzung zum objektiv Gewussten. Unmittelbar ist die erste Einstellung nämlich überhaupt nicht lesbar, fügt sie sich zu keiner Erfahrung. Erst durch die Zutat von Pasolinis Stimme verbinden sich die undeutlichen Züge zu einer Form, und kann die Form schließlich als Gesicht erkannt werden. Stimme und Bild gehen hier eine vorübergehende Verbindung ein, worin keines dem anderen überlegen ist. Die Stimme teilt ein Wissen mit, das die Bilder bereits in sich tragen. Weil sie aber buchstäblich zu nah dran sind – zu nah dran, um scharf zu sehen – teilt sich dieses Wissen nicht mit. Erst Pasolinis akusmatischer Eingriff schafft die nötige Distanz, die Schemen als Figuren wahrzunehmen und die gezeigte Situation zu verstehen. Die unmittelbare Erfahrung verstellt den Blick auf die ihr zugrunde liegende Struktur. Die Stimme bemüht sich darum, die Struktur herauszustellen, die dieser Unmittelbarkeit zugrunde liegt.
Das ist ein ganz anderes Modell als jenes des herkömmlichen Dokumentarfilms. Anstatt dem Bild eines Gegenstands ein Wissen hinzuzufügen, das unabhängig von der filmischen Gestaltung dieses Gegenstands besteht, anstatt also ein Außerfilmisches zu setzen, dem das Filmische hierarchisch untergeordnet ist, verbleibt er ganz auf der Immanenzebene der Bilder, um von dort aus die Logik des Dokumentarischen nachgerade zu verkehren: Da der Rekurs auf eine Wirklichkeit außerhalb des Filmischen nicht mehr verfängt, hat Pasolinis Stimme keinen sicheren Rückzugspunkt mehr. Sie ist genötigt, ihren Ort in den Bildern zu finden, in einen gleichberechtigten Dialog mit ihnen zu treten. Die Stimme ist nicht Belehrung von einem epistemisch privilegierten Ort aus, sondern Antwort auf eine spezifische Frage. Dies festzuhalten ist sehr wichtig, da viele von Pasolinis Äußerungen im weiteren Verlauf von APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA unter dieser Voraussetzung in einem anderen Licht erscheinen werden.
4.2. Analyse im Schnelldurchlauf
„Wir sind in Argos“, mit diesen Worten eröffnet Pasolinis Stimme einen Reigen von nahen und halbnahen Aufnahmen: Männer, Frauen und Kinder, Gesichter, junge und alte. Manchmal umfasst der Kader ganze Gruppen von dicht beisammen gedrängten Menschen, im Hintergrund umrisshaft ein dörfliches Setting. Durch ihre Frontalität und Rezeptivität gegenüber dem profilmischen Geschehen ist die agile Handkamera als dokumentarisch gekennzeichnet. Auch die Reaktionen der Angeblickten weisen in diese Richtung. Manche erwidern den Blick ohne Scham, andere richten ihn betreten zu Boden, wieder andere versuchen, indem sie aus dem Bild drängen, sich seinem Zugriff ganz zu entziehen. Pasolinis Stimme schlägt eine Brücke nicht nur zu den Schauplätzen, sondern auch zum Personal der Orestie: „Dieser hier (questo) könnte ein Agamemnon sein... Auch dieser: ein alter Agamemnon, der vom trojanischen Krieg zurückkehrt... Eine andere Variante für einen möglichen Agamemnon, sagenhafter und mythischer, aus dem Stamm der Massai.“
Im Durchgang dieser Galerie möglicher Darsteller setzt die Stimme den Plot des Dramas fort: Agamemnon, der König von Argos, kehrt mit der geraubten Kassandra aus dem trojanischen Krieg zurück. Seine Gattin Klytämnestra ermordet ihn aus Rache für den Tod ihrer gemeinsamen Tochter Iphigenie, die Agamemnon den Göttern geopfert hat. Iphigenies Schwester Elektra sinnt nun ebenfalls auf Rache. Als ihr Bruder Orest, der bei einem Gastfreund Agamemnons aufgewachsen ist, an den Hof der Atriden zurückkehrt, verbünden sich die Geschwister gegen ihre Mutter. Nachdem Orest das Schwert gegen Klytämnestra gerichtet hat, wird er von den Erynnien, antiken Rachegöttinnen, bis vor die Tore Athens verfolgt. In der weisen Athene findet er eine Fürsprecherin, die dem Morden ein Ende bereiten will, indem sie Orest der Gerichtsbarkeit überantwortet. Der Prozess findet in Athen statt und endet in einem Freispruch. Die erzürnten Erynnien lassen sich durch Athenes Überredungskünste erweichen. Gegen einen Platz am Hofe erklären sie sich bereit, den Zwist beizulegen und verwandeln sich von Rachegöttinnen in Eumeniden, die Wohlmeinenden.
Nach und nach defilieren alle zentralen Charaktere und Schauplätze an der Linse vorüber: Kassandra, Klytämnestra, Elektra, Orest, die Erynnien; Troja, Argos, Athen. Selten vollzieht sich die Identifikation der Porträtierten ohne Reibungsverlust. Das Bild einer ältlichen Frau etwa, die ihre Faust gegen den Betrachter reckt, wird von einer Erklärung Pasolinis begleitet, wonach die Ähnlichkeit allein in der isolierten Geste liegt: „Das hier ist nicht gerade Kassandra, die jung und schön war, aber das hier (questo) könnte eine ihrer magischen Gesten sein.“ Über Elektra urteilt Pasolinis Stimme, sie sei „diejenige Figur, die im heutigen Afrika zu finden die größten Schwierigkeiten bereitet.“ Orest dagegen wird im Bildnis eines jungen Mannes betont lapidar – ohne Relativierung, ohne Konditionell – eingeführt: „Orest.“ Auch bleibt es, im Gegensatz zu den anderen Figuren, derer jeweils mehrere Varianten vorgeschlagen werden, bei einer Person, bei einem Gesicht.
Schon den besonderen Charakteren eignet ein Zug ins Allgemeine – etwas von Agamemnon findet Pasolini in einer Anzahl afrikanischer Männer wieder, etwas von Elektra ist in der Mehrzahl afrikanischer Frauen schwer zu finden. Bei der Suche nach den Mitgliedern des Chors kommt dem Allgemeinen noch größeres Gewicht zu. Auf einige Aufnahmen verstreuter Objekte, die sich zur Lebenswelt der Bewohner einer Hütte am Viktoriasee verdichten, folgt die Ausdifferenzierung sozialer Archetypen innerhalb dieser Lebenswelt. Erst „die Mutter“, „ihr Kind“, „der Vater“, dann – auf den familiären Zusammenhalt folgt unterschiedslos und gleichberechtigt die Anbindung an die Dorfgemeinschaft – „die Nachbarin“ Von hier aus führt die querschnittartige Charakterisierung der Chormitglieder zur manuellen Feldarbeit, über Dörfer und Märkte zu Fabriken und Schulen.
An dieser Stelle verlässt APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA sprungartig die etablierte Erzähl- oder eigentlich Rechercheebene und begibt sich in einen steril ausgekleideten Vorführraum. Pasolini spricht, an seiner Stelle sind konzentrierte Gesichter zu sehen, die seinen Worten, die Stirn in Falten gelegt, lauschen. Wie sich herausstellt, gehören sie afrikanischen Studenten in Rom, die dazu angehalten sind, das bisher Gesehene zu kommentieren. Der erste Befragte ist der Ansicht, dass Pasolinis Film eine Dekade zu spät komme; Afrika sei bereits modernisiert, der Konflikt im Zentrum der Orestie obsolet bzw. überwunden. Der zweite, ein Äthiopier, spricht sich gegen die Generalisierung aus, die sich in der Bezeichnung „afrikanisch“ ausspreche und dem ganzen Projekt zugrunde liege. Er sagt: „Ich kenne Afrika nicht“.
Im Anschluss an diesen kurzen Exkurs schaltet der Film in seinen früheren Modus zurück und setzt die Recherche nach Orten und Figuren der Orestie fort. Nachdem das sterbliche Personal vollständig besetzt ist, steht Pasolini vor einem Repräsentationsproblem. Welches Bild soll für die Erynnien einstehen? Kein einzelnes: Zunächst kommt Pasolini auf den Topos des Baums zurück, der schon am Anfang des Films der Beschwörung einer archaischen Vorzeit diente. Oft in Untersicht und mit einem Freejazzscore unterlegt, der sich aus rhythmischen Kontrabassanschlägen, einem an- und abschwellenden Trommelwirbel und einer zwischen hohen und tiefen Tönen mäandernden Saxophonleitstimme zusammensetzt, nehmen in Art und Wuchs verschiedene Bäume den Bildkader ein, um allmählich von immer spärlicher besiedelten Steppenlandschaften verdrängt zu werden. Darin eine verletzte Löwin, die Pasolinis ortlose Stimme als Sinnbild des Animalischen im Menschen ausweist. Dies ist wohlgemerkt nicht dahingehend misszuverstehen, dass Pasolini die antiken Rachegöttinnen in dieser oder jener Gestalt vergegenständlichen wolle. Die Bäume oder die angeschlagene Löwin fungieren nicht als metaphorische Repräsentationen, sondern vermitteln kraft ihrer Gleichgültigkeit bzw. blinden Wut eine sinnlich-konkrete Erfahrung von Qualitäten, die auch den Erynnien zu eigen sein könnten.
Im Anschluss spricht Pasolini von der Möglichkeit einer Rückblende zum Trojanischen Krieg, zeigt mögliche Orte, die das Lager der Griechen darstellen könnten, dann found footage von afrikanischen Militärs, die er als Agamemnon, Menelaos, Ajax, Odysseus anspricht, schließlich marschierende Soldaten. Es handelt sich um Nachrichtenaufnahmen vom Sezessionskrieg zwischen Nigeria und der erdölreichen, nach Autonomie strebenden Region Biafra (1967-70). Pasolini erläutert sein Verfahren zur Aneignung dieser Archivbilder: Die Bilder seien nicht Bilder eines konkreten, sondern eines abstrakten Krieges, Bildmetaphern, die den Krieg zwischen Griechen und Trojanern aktualisierten. Gegenüber jener sinnlichen Konkretion, die im Fall der Erynnien als Transmissionsriemen zwischen Gegenwart und Vergangenheit fungierte, erscheint die große Geste, mit der die Stimme aus dem Off den zeitgeschichtlichen Kontext des Biafra-Kriegs vom Tisch wischt, umso anmaßender.
In einer neuerlichen Wendung begibt sich APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA in ein „semi-klandestines Studio in einer westlichen Stadt“. Dort versammelt Pasolini drei Musiker und zwei Sänger, um die Orestie „zu singen“. Es kann dies als eine verspätete Antwort auf das im Zusammenhang der Erynnien aufgeworfene, eigentlich aber den gesamten Film betreffende Repräsentationsproblem angesehen werden. Wenn es sich darum handelt, dem Publikum nicht nur Darstellungen des Archaischen vorzusetzen, sondern darüber hinaus die sinnliche Teilhabe daran zu ermöglichen, bietet sich Gesang, in der Tradition Rousseaus der unmittelbarste und jeder pragmatischen Intention vorgängige Ausdruck von Mitmenschlichkeit,[58] als Mittel der Wahl an.
Die Interpreten sind Afroamerikaner, da diese, so erklärt die Stimme des Autors, die politische Avantgarde der Befreiungskämpfe in der Dritten Welt bildeten. Da es Pasolini nicht um Symbolpolitik, sondern um die Vermittlung sinnlich-konkreter Teilhabe geht, ist diese Selbstauskunft aber mit Vorsicht zu genießen. Untergründig mischt sich die Vorstellung ein, dass in den Vibrationen der Stimmbänder, die im Zuschauer widerhallen, das Leid und der Kampf eines Volks mitschwingen; nicht als verbal-metaphorisches, sondern physisch-konkretes Pathos. Die instrumentale Begleitung entpuppt sich als jenes amelodische und dissonante Jazzarrangement, das zuvor die Qualitäten der Erynnien evozieren sollte. Pasolini kündigt „il primo appunto“, die erste Note an. Von hier aus schlüsselt sich eine andere Lesart des Filmtitels auf: Nicht Notizen, sondern Noten für eine afrikanische Orestie. Noten für eine musikalische Komposition, die – im Sinne Rousseaus – hinter die Verzweckung des Worts zurückgehen und eine vorsprachliche Wirklichkeit zum Vorschein bzw. zum Klingen bringen kann. Mit dieser Lesart reimt sich der Umstand, dass die ausdrücklichen, i. e., von Pasolini als solche angesprochenen, Probleme der Repräsentation stets unter Zuhilfenahme dieses Jazzscores angegangen werden.
Zurück in Afrika richtet Pasolini ein paar stumme, auf einige wenige Gesten reduzierte Szenen der Orestie ein. Eine Szene ist ansatzweise aufgelöst: Elektras Totenwache am Grab ihres Vaters. Pasolini erklärt, er habe seine Darstellerin angewiesen, die ihr vertrauten Grabesriten zu vollführen und legt ihrem filmischen Abbild Elektras Gebet in den Mund. Die Lippen der Frau bewegen sich nicht, und auch sonst sind Worte und Bild unzureichend synchronisiert. Noch bevor Pasolinis Rezitation von Elektras Gebet beendet ist, verlässt die Frau das Grab. Eine andere solche Szene wird eigens hervorgehoben: Sie sei so gedreht und montiert worden, wie sie in den fertigen Film eingehen soll. Erst sieht man Orestes am Grab seines Vaters, dann wie er, nachdem er seine Mutter getötet hat, vor den Erynnien flieht. Wiederum sind es nicht die Erynnien selbst, sondern das ungestüme Vorwärtsstieben vom Wind gebeutelter Bäume, worin weniger die äußerliche Handlung denn die Qualität des Verfolgens zum Ausdruck gelangt.
Das Athen, in dem Orests Flucht endet, ist Ugandas Hauptstadt Kampala, für den Tempel des Apollo, worin ihm der Prozess gemacht wird, steht die Universität von Dar-es-Salam, da sie, wie Pasolini ausführt, Ähnlichkeiten mit den kapitalisierten Universitäten angelsächsischer Prägung aufweise. Über Orests Schicksal entscheidet eine von Sterblichen getroffene Wahl; Pasolini bringt sie mit den ersten freien Wahlen des unabhängigen Afrika in Verbindung, die nach seiner Meinung einem Modell von Demokratie zum Aufstieg verholfen hätten, das dem der – von ihm und der europäischen Linken einhellig kritisierten – parlamentarischen Demokratien ähnelt. In einem kurzen Nachspiel spitzt Pasolini das Ergebnis seiner Recherchen für eine afrikanische Orestie noch einmal zu. Die residuale Vorgeschichtlichkeit Afrikas sei im Verschwinden begriffen, der Übergang von vormodernen zu demokratischen Gesellschaftsformen vielerorts bereits vollzogen oder auf den Weg gebracht. Dies zu illustrieren, verfolgt die Kamera zwei traditionelle, inzwischen aber von der Säkularisierung erfasste Riten, einen Tanz und eine Hochzeit. Was früher einen präzisen religiösen Sinn gehabt hat, ist nun eine spielerische – und womöglich: ästhetische – Praxis. In der Orestie konfrontieren die olympischen die älteren Götter und transformieren sie zu Eumeniden. In Pasolinis Auslegung stehen die Erynnien für das Alte, Archaische, für Irrationalität und das Reale, die Olympier indes für das Neue, die Ratio (des Staates), das Symbolische. Die Verwandlung der Erynnien zu Eumeniden fasst er folglich als politische Symbolisierung und ästhetische Sublimierung.[59] Der Moment des Übergangs, der in der Orestie eine mythologische Bearbeitung erfährt, schien 1970 vorüber zu sein. Die Idee zu einer afrikanischen Orestie, meint Pasolini schließlich zugeben zu müssen, komme wenigstens zehn Jahre zu spät.
Soweit das explizite Argument von APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA. Bei näherer Betrachtung der einzelnen Segmente – als da wären: die Suche nach Schauplätzen und Personen, die Befragung der Studenten, das musikalische Intermezzo, die Aneignung von found footage als Elemente einer möglichen Rückblende, die inszenatorischen Gehversuche und die ausgeführte Szene um Orest – schleicht sich der Verdacht ein, Pasolini habe von seinem ursprünglichen Vorhaben nicht nur deshalb abgelassen, weil es von den Zeitläuften überholt worden war.
Wie in der vorangegangenen Detailanalyse exemplifiziert, zieht sich Pasolinis Off-Kommentar niemals auf ein den Bildern äußerliches und/oder vorgängiges Terrain zurück – auch nicht, wenn er auf eine kanonische Ursprungserzählung der europäischen Geistesgeschichte rekurriert –, sondern setzt sich in ein gleichberechtigtes, dialogisches Verhältnis zu ihnen. Pasolinis akusmatische Stimme stiftet Parallelen, Analogien und willkürliche Verbindungen zwischen der Gegenwart Afrikas und der mythischen Vergangenheit Europas. Bisweilen, in besonders suggestiven Bild-Ton-Montagen, schrumpft der Abstand zwischen beiden auf ein Minimum, öfter jedoch tritt er umso konturierter hervor. Der tentative Charakter von Pasolinis Zuschreibungen äußert sich in seinem konjunktivischen Sprechen – „Dieser hier könnte ein Agamemnon sein“ – und nicht selten muss er konzedieren, dass die Bilder sich dem Zugriff entziehen oder gar widersetzen: Eine junge Frau erwidert den Blick der Kamera mit einem Lächeln, zu dem Elektra nicht imstande wäre, das historisch spezifische Bildmaterial vom Biafra-Krieg kippt auch auf Pasolinis Zuruf nicht ins Ahistorische und die befragten Studenten äußern sich nicht nur bezüglich des zeitgeschichtlichen Timings von Pasolinis Vorhaben skeptisch. Ihre Kritik setzt tiefer an, genauer bei seiner monolithischen und homogenen Vorstellung von „Afrika“ und mithin an den thetischen Grundfesten seiner „afrikanischen“ Orestie.
Bei aller Thesenfestigkeit, mit der die Stimme des Autors einen roten Faden durch das heterogene Bildmaterial zu weben sucht, verliert APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA doch an beinahe keiner Stelle aus dem Blick, welche Anmaßung – an den Maßstab Europas – das ganze Projekt informiert. Selbst da, wo Pasolini die Bilder seinem Anliegen gemäß bezeichnet und einordnet, gibt er Acht, ihr Eigenleben und ihre eigene Bewegung nicht zu verdecken. Denn genau darum, was die Eigenheit Afrikas gegenüber den westlichen Industriegesellschaften ausmacht, ist es ihm ja gerade zu tun.
Die wenigen Momente, in denen die Suggestivkraft der Stimme die Bilder ein- und überholt, sind diesen mühsam abgetrotzt und beziehen gerade daraus ihre besondere Kraft. So oft die Identifikation von Orten und Personen scheitert, so oft gelingt die unmittelbare Überblendung einzelner, aus dem Zusammenhang gelöster Gesten und Qualitäten. Was im Gleichnis von europäischer Antike und gegenwärtigem Afrika pauschalisierend und reduktionistisch anmutet, erhält in der gereckten Faust der alten Frau, die zum magischen Handgriff Kassandras gerät, eine zeit- und geschichtslose, eben: archaische Evidenz. Solche Momente aufgeladener Sinnlichkeit überzeugen zwar nicht als politische Analyse des postkolonialen Afrika – das tut eigentlich keine von Pasolinis Überlegungen längs der rassistischen Achse von europäischer Ratio und afrikanischer Sinnlichkeit –, noch holen sie die mythische Vorzeit als sinnliche Erfahrung ein. Als Wiedereinübung in eine ästhetische Wahrnehmung, als Mittel „to restore an epic and mythological dimension to life, a sense of awe and reverence to the world”[60] taugen sie allemal. Da ist es nur folgerichtig, dass Pasolini sich im Anschluss an APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA nun auch von der Dritten Welt abwenden wird, um sein Heil im Mittelalter von IL DECAMERON (Italien 1971), I RACCONTI DI CANTERBURY (Italien 1972) und IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE (Italien 1974) zu suchen.
5. Ausblick: Die Krise des eurozentrischen Laufbilds
Um es vorsichtig zu formulieren: Pier Paolo Pasolinis APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA gibt Zeugnis von einer Reihe zusammenhängender Entwicklungen in den langen 1960er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Allgemein von der tief greifenden Rekonfiguration des geopolitischen Machtgefüges im Gefolge der Dekolonisierung; genauer vom Verlust der Deutungshoheit europäischer Linksintellektueller über die Begriffe des Politischen und der Revolution; spezifisch, i. e., mit Blick auf das westeuropäische Autorenkino, von der Krise des eurozentrischen Laufbilds.
Der Versuch, die eigenen Bilder – die Selbstdarstellungen und -erzählungen Europas – in periphere Kontexte zu verlängern, gibt sich bestenfalls als Anmaßung, schlimmstenfalls als kolonisierende Gewalt zu erkennen. Obwohl Pasolini bemüht ist, sich in ein unhierarchisches Dialogverhältnis zu den Bildern des Anderen zu setzen, ihnen ein Eigenleben einzuräumen, trifft er überall auf Widerstände und Unvereinbarkeiten. Das mag unter anderem daran liegen, dass sich den jungen afrikanischen Nationalstaaten bis zum Ende der 1960er-Jahre nur vereinzelt die Gelegenheit geboten hatte, sich selbst ins Bild zu setzen: Der erste von einem schwarzen afrikanischen Regisseur auf afrikanischem Boden realisierte Film in der Geschichte des Mediums, da sind sich die Chronist/innen einig,[61] ist Ousmane Sembènes BOROM SARRET von 1963.
Pasolinis „Afrika“ – die Argumentation ließe sich vermutlich auf Antonionis oder Godards „China“ und weitere solcher Wahlverwandtschaften ausdehnen – besteht zur Gänze aus Bildern, die sich der Okzident davon gemacht hatte. Dass sich im postkolonialen Afrika, vor allem in den frankophonen Ländern auf dem Territorium des ehemaligen Französisch-Westafrika, seit Sembènes Pioniertat eigenständige Kinematographien herausgebildet hatten, die solchen Projektionen selbstbewusst entgegen traten,[62] findet im kreisförmigen Selbstgespräch von APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA keine Berücksichtigung. Deshalb mündet der angestrebte Dialog in einen Zirkelschluss: Pasolini kann am Ende nichts aus seinem Afrika bergen, was er nicht selbst hineingelegt hat.
[1] Zur geopolitischen Periodisierung der „langen 1960er-Jahre“ vgl. Jens Kastner/David Mayer, Zur Einführung, in: Dies. (Hg.),Weltwende 1968? Ein Jahr aus globalgeschichtlicher Perspektive, Wien 2008, S. 7-22, hier S. 11.
[2] Jean-Paul Sartre, Vorwort [1961], in: Frantz Fanon, Die Verdammten dieser Erde[1961], Frankfurt am Main 1981, S. 7-27, hier S. 24.
[3] Situationistische Internationale, Der Beginn einer Epoche [1969], in: Dies., Gesammelte Ausgaben des Organs der Situationistischen Internationale (Bd. 2), Hamburg 1977, S. 329-364, hier S. 330.
[4] Um nur einige Beispiele zu nennen: LES STATUES MEURENT AUSSI (Frankreich, 1953, R: Chris Marker und Alain Resnais), LES MAÎTRES FOUS (Frankreich, 1955, R: Jean Rouch), SALUT LES CUBAINS (Frankreich/Kuba, 1963, R: Agnès Varda), LA BATTAGLIA DI ALGERI (Italien/Algerien, 1966, R: Gillo Pontecorvo), LA CHINOISE (Frankreich, 1967, R: Jean-Luc Godard), LOIN DU VIETNAM (Frankreich, 1967, R: Joris Ivens, William Klein, Claude Lelouch, Agnès Varda, Jean-Luc Godard, Chris Marker, Alain Resnais), BLACK PANTHERS (USA, 1968, R: Agnès Varda) oder CHUNG KUO – CINA (Italien, 1972, R: Michelangelo Antonioni).
[5] Pier Paolo Pasolini, Die KPI an die Jugend!! (Notizen in Versen für ein Gedicht in Prosa, gefolgt von einer ‚Apologie’) [1968], in: ders., Ketzererfahrungen, ‚Empirismo eretico’: Schriften zu Sprache, Literatur und Film[1972], München 1979, S. 179-186, hier S. 182.
[6] Etliche seiner Filme, z. B. MEDEA (Italien, 1969) oder APPUNTI PER UN FILM SULL’INDIA (Italien, 1968), wären geeignet, das Verhältnis Europas – vielleicht muss es einschränkend heißen: das Verhältnis europäischer Intellektueller – zur Dritten Welt exemplarisch darzustellen. Pasolinis eigene Faszination für diesen Topos findet indes nirgends einen derart dichten und unverstellten Ausdruck wie in APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA.
[7] Zum Begriff der episteme vgl. Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge: Eine Archäologie der Humanwissenschaften, Frankfurt am Main 1974. Ausgehend von der These, dass empirisches Wissen zu einem gegebenen Zeitpunkt und an einem gegebenen Ort eine „wohldefinierte Regelmäßigkeit“ (a.a.O., S. 9) besitzt, entwickelt Foucault die Konzeption eines historischen Apriori, das als gemeinsame Grundlage allen Wissens festlegt, was gewusst werden kann bzw. wie die Erkenntnis von einem Gegenstand beschaffen sein muss, um als solche zu gelten. Wissen ist stets an den „spezifischen epistemologischen Raum einer bestimmten Epoche“ (a.a.O., S. 11) und, so muss man ergänzen, eines bestimmten Ortes gebunden.
[8] Die so genannte Verelendungstheorie findet sich, wenngleich nicht unter dieser Bezeichnung, zwar im Kommunistischen Manifest, das ob seines Pamphletcharakters aber als Propagandaschrift einzustufen ist. In Marx’ theoretischen Ausarbeitungen dagegen ist davon keine Rede, zumal das unvollendet gebliebene Kapitel über den Begriff der Klasse im dritten Band des Kapital lediglich vier Absätze umfasst; vgl. Karl Marx, Das Kapital (Bd. 3) [1894], Berlin 1949, S. 941f.
[9] Vgl. Thomas Hecken, 1968. Von Texten und Theorien aus einer Zeit euphorischer Kritik, Bielefeld 2008, S. 70.
[10] Herbert Marcuse, Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft[1964], Frankfurt am Main 1989 (= Ders., Schriften, Bd. 7), S. 15.
[11] Vgl. Hecken, 1968, S.132.
[12] Vgl. Karl Marx/Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei[1872], Berlin 1980, S. 42.
[13] Tatsächlich wurde das Aufbegehren etwa der konservativen Nation of Islam oder der linksradikalen Black Panther Party for Self-Defense immer wieder zu den Befreiungskämpfen auf dem afrikanischen Kontinent in Beziehung gesetzt, und im Umkehrschluss die rassistische Unterdrückung in den USA als quasi kolonialistische gebrandmarkt; vgl. dazu Albert Scharenberg, Die Bürgerrechtsbewegung in den USA, in: Kastner/Mayer, Weltwende 1968, S. 159-171.
[14] Vgl. Marcel van der Linden, 1968: Das Rätsel der Gleichzeitigkeit, in: Kastner/Mayer, Weltwende 1968, S. 23-37, hier S. 30.
[15] Der Fokustheorie zufolge ist es die Aufgabe einer bewaffneten Gruppe entschlossener Revolutionäre, die Revolution in die Landbevölkerung „hineinzutragen“.
[16] Vgl. Hecken, 1968, S. 55f.
[17] Vgl. Christoph Kalter, „Le monde va de l’avant. Et vous êtes en marge“: Dekolonisierung, Dezentrierung des Westens und Entdeckung der „Dritten Welt“ in der radikalen Linken in Frankreich in den 1960er Jahren, in: Archiv für Sozialgeschichte 48 (2008), S. 99-132, hier S. 125.
[18] Hecken, 1968, S. 52.
[19] Vgl. zu diesem Begriff François Lyotard, Das postmoderne Wissen [1979], Wien 1999.
[20] Claude Lévi-Strauss, Das wilde Denken[1965], Frankfurt am Main 1973, S. 12.
[21] Lévi-Strauss, Das wilde Denken, S. 21.
[22] Ibid.
[23] Lévi-Strauss, Das wilde Denken, S. 27.
[24] Vgl. Knut Hickethier, Genretheorie und Genreanalyse, in: Jürgen Felix (Hg.), Moderne Film Theorie, Mainz 2003, S. 62-103.
[25] Auch in der Auseinandersetzung mit dem Medium Film erlangte der Begriff der Repräsentation einige, wenngleich negative Berühmtheit. Die Rede von einer Politik der Form zielte auf ein größeres Bewusstsein für die politischen Implikationen medialer Formen, die von der Hollywood’schen Illusionierung eines transparenten Realismus bis zu den „ideologischen Effekten des Basisapparats“ (vgl. Jean-Louis Baudry, Ideologische Effekte erzeugt vom Basisapparat [1970], in: Robert Riesinger (Hg.), Der kinematografische Apparat: Geschichte und Gegenwart einer interdisziplinären Debatte, Münster 2003, S. 27-39) reichen konnten. Die hier angesprochene Kritik der Repräsentation ist jedoch anders gewichtet.
[26] Vgl. Guy Debord, Die Gesellschaft des Spektakels [1967], Berlin 1996, S. 23.
[27] Vgl. Debord, Gesellschaft des Spektakels, S. 24f.
[28] Es soll nicht unterschlagen werden, dass gleichzeitig die Marginalisierung des Südens voranschritt und proletarisch geprägte Vorstädte der Ghettoisierung anheimfielen; vgl. hierzu Dario Azzelini, Das lange italienische 1968, in Kastner/Mayer, Weltwende 1968, S. 172-187.
[29] Vgl. Azzelini, Das italienische 1968, S. 183.
[30] Vgl. z. B. Pier Paolo Pasolini, Bürgerkrieg [1966], in: Ders., Ketzererfahrungen, S. 179-186, hier S. 179.
[31] Pier Paolo Pasolini, Die „Sprache“ der Haare [1973], in: Ders., Freibeuterschriften. Die Zerstörung der Kultur des Einzelnen durch die Konsumgesellschaft(hg. von Agathe Haag), Berlin 1979, S. 19-24, hier S. 20.
[32] Jean Duflot, Rätsel. Interview mit Pier Paolo Pasolini, in: Peter W. Jansen/Wolfram Schütte (Hg.), Pier Paolo Pasolini, München 1977, S. 85-94, hier S. 92; vgl. auch Fabien S. Gérard, Pasolini ou le mythe de la barbarie, Brüssel 1981.
[33] Jansen/Schütte, Pasolini, S. 165.
[34] Ibid., S. 164.
[35] Vgl. Pasolini, KPI an die Jugend, S. 196; Jansen/Schütte, Pasolini, S. 163f.
[36] „Hegel! Sade! Der Mythos! Nun ja, wenn ich von der Natur spreche, ist immer der „Mythos der Natur“ gemeint: Ein antihegelianischer und antidialektischer Mythos, weil die Natur keine „Aufhebungen“ kennt; alles liegt unverbunden nebeneinander und koexistiert.“ (Übersetzung N.P.) Aus: Jean Duflot, Pier Paolo Pasolini. Entretiens avec Jean Duflot [1970], Paris/Montréal 2007, S. 83.
[37] Pasolini, Bürgerkrieg, S. 181.
[38] Vgl. Antonio Gramsci, Anmerkungen und Notizen für eine Reihe von Arbeiten zur Geschichte der Intellektuellen (Auszug: Organische und traditionelle Intellektuelle) [1932], in: Ders., Gedanken zur Kultur (hg. von Guido Zamis), Leipzig 1987, S. 85-90.
[39] Bernhard Groß, Pier Paolo Pasolini: Figurationen des Sprechens, Berlin 2008, S. 137.
[40] 1969 unternahmen die argentinischen Filmemacher Fernando E. Solanas und Octavio Getino den Versuch, das Medium des Films für den antikolonialen Kampf in Dienst zu nehmen und forderten ein eigenständiges Kino der Dritten Welt. Jenseits von Hollywood sollte es verortet sein, aber auch jenseits des mit der europäischen Linken assoziierten Autorenfilms. Das Manifest, worin diese Forderungen laut wurden, trägt den Titel „Hacia un tercer cine“, für ein Drittes Kino. Für ein Kino, das in enger Verschränkung mit den sozialen Bewegungen in Lateinamerika, Afrika und Asien gegen die Herrschaft des Neokolonialismus und für eine Internationale der Peripherie – die „Trikontinentale“, wie sie auf der legendären antiimperialistischen Konferenz von Havanna im Jahr 1966 getauft wurde – kämpfen sollte; vgl. Fernando E. Solanas/Octavio Getino, Towards a Third Cinema [1969], in: Bill Nichols (Hg.), Movies and Methods. An Anthology, Berkeley 1976, S. 44-64.
[41] Gilles Deleuze, Das Zeit-Bild: Kino 2 [1985], Frankfurt am Main 1997, S. 277ff.
[42] Pier Paolo Pasolini, Das „Kino der Poesie“, in: Jansen/Schütte, Pasolini, S. 49-77, hier S. 60.
[43] Pasolini, Kino der Poesie, S. 61.
[44] Ibid.
[45] Auch diese Analogie ist freilich problematisch. Als Subjektive kann eine Einstellung durch ihre Einbettung in die räumliche Artikulation einer Sequenz markiert werden, oder durch immanente, jedoch konventionelle und also historisch variable Eigenschaften. Diese Markierungen haben aber stets etwas Vorläufiges und Ungewisses, wie die oftmalige Erkenntnis post factum, dass die eben gesehene Einstellung den Blickpunkt einer diegetischen Figur vorstellen sollte, beweist. Die Subjektive wird durch nichts so eindeutig ausgewiesen wie die direkte Rede durch die Anführungsstriche am Anfang und Ende einer Aussage. Grundlegender kann das Problem der Subjektive auf die Diskrepanz zwischen der menschlichen Wahrnehmung und der interesselosen Registratur der Kamera zurückgeführt werden.
[46] Paolo Fabbri, Free/Indirect/Discourse, in: Patrick Rumble/Bart Testa (Hg.), Pier Paolo Pasolini: Contemporary Perspectives, Toronto 1994, S. 78-87, hier S. 82.
[47] Pasolini, KPI an die Jugend, S. 194.
[48] Pasolini, Bürgerkrieg, S. 185.
[49] Pasolini, KPI an die Jugend, S. 194.
[50] „Ich betrachte mich mit der Kamera in der Vitrine eines Geschäfts in einer afrikanischen Stadt.“ (Übersetzung N.P.)
[51] „Ich bin offensichtlich gekommen, um zu drehen – aber was zu drehen?“
[52] „Weder eine Dokumentation, noch einen Film, sondern Notizen für einen Film.“
[53] „Der Film wird Aischylos’ Orestie sein, Drehort das heutige Afrika.“
[54] Karl Marx, Das Kapital (Bd. 1) [1867], Berlin 1972, 49.
[55] Ibid.
[56] Michel Chion, Audio-Vision: Sound on Screen [1990], New York 1994, 71f.
[57] Ich will keineswegs eine erschöpfende Darstellung der vielfältigen Sprecherpositionen im Dokumentarfilm geben, sondern lediglich die Beschreibung eines bestimmten, nicht nur in einschlägigen Fernsehformaten vorherrschenden Selbstverständnisses des Dokumentarischen.
[58] vgl. Jean-Jacques Rousseau, Essay über den Ursprung der Sprachen, worin auch über Melodie und musikalische Nachahmung gesprochen wird [1761], in: Ders., Musik und Sprache. Ausgewählte Schriften, Wilhelmshaven 1984, S. 99-168.
[59] Vgl. Sam Rhodie, The Passion of Pier Paolo Pasolini, London 1995, S. 87f.
[60] Oswald Stack, Pasolini on Pasolini, London 1969, S. 9.
[61 Vgl. Marie-Hélène Gutberlet, Auf Reisen. Afrikanisches Kino, Frankfurt am Main 2004, S. 106; Nwachukwu Frank Ukadike, Black African Cinema, Berkeley 1994; David Murphy/Patrick Williams, Postcolonial African cinema: Ten directors, Manchester 2007, S. 50.
[62] Klassischer Ort dieser Auseinandersetzung ist ein Streitgespräch, das Sembène im Jahr 1965 mit dem französischen Ethnografen Jean Rouch führte; vgl. „Du schaust uns an, als wären wir Insekten.“ Eine historische Gegenüberstellung zwischen Jean Rouch und Ousmane Sembène im Jahr 1965 (Übersetzung von Caroline Gutberlet), in Marie-Hélène Gutberlet/Hans-Peter Metzler (Hg.), Afrikanisches Kino, Bad Honeff 1997, S. 29-32.