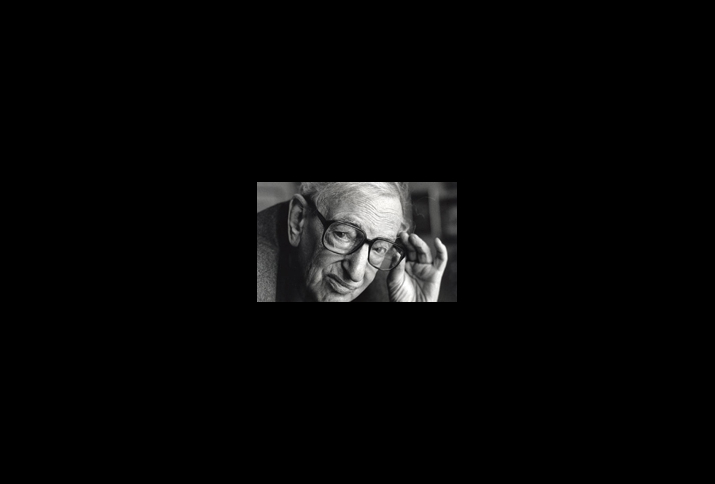Dies waren die Umstände von Eric Hobsbawms Kindheit und Jugend: Er wurde am 9. Juni 1917 in Alexandria als Sohn eines Engländers und einer Österreicherin geboren und wuchs zweisprachig in Wien und Berlin im unteren Mittelstand, aber in einer transnationalen Welt auf. Das Trauma von verlorenem Krieg und Zusammenbruch der Monarchien, von Revolution und Inflation, von nur halb geglückter Demokratisierung und politischer Polarisierung prägte das Leben seiner Umwelt in beiden Großstädten. Hobsbawms Umwelt, das war vor allem seine weitverzweigte jüdische Verwandtschaft, die ihm nach dem allzu frühen Tod beider Eltern Halt bot, das war aber auch die Welt der Kultur und die Politik, die den Gymnasiasten ergriff und nie mehr losließ. Hobsbawms Rückblick blieb stets frei von jeder Nostalgie auf die verschwundene Welt des Mitteleuropa der Kaiserreiche, deren Geist auch in der Zwischenkriegsepoche noch spürbar war.
Die großen sozialen Gegensätze, der Nationalismus und Antisemitismus bewogen den jungen Hobsbawm, sich auf die Seite der Linken zu schlagen, die aber selbst zutiefst uneinig war. „Die englische Staatsbürgerschaft immunisierte mich wahrscheinlich und zum Glück auch gegen die Verlockungen eines jüdischen Nationalismus, wenngleich der Zionismus unter der mitteleuropäischen Jugend im allgemeinen mit gemäßigten oder revolutionären sozialistischen Auffassungen Hand in Hand ging“, so Hobsbawm.[2] Am Berliner Prinz-Heinrichs-Gymnasium, an dem er die dramatische Endphase der Weimarer Republik erlebte, herrschte ein konservativer Geist, wenngleich der Nazismus nicht dominierte. Es war somit keineswegs ausgemacht, daß Hobsbawm Anschluß an das Milieu der KPD finden würde. Dass dies geschah, war dem beharrlichen Werben eines etwas älteren Jungkommunisten geschuldet, der wie Hobsbawm Familienangehörige in England hatte. Rudolf Leder wurde später unter seinem Schriftstellernamen Stephan Hermlin berühmt.
Obwohl Hobsbawm durch seinen britischen Paß nach der Errichtung des Hitler-Regimes geschützt war, ging er mit seinen Verwandten, deren wirtschaftliche Existenz durch den antijüdischen Boykott zerstört wurde, nach England. Hobsbawm konnte aber Berlin nicht vergessen, und sein Tagebuch führte er weiterhin auf Deutsch. Doch wurde er zunehmend „britischer“, und die Erfahrungen des Wechsels von einer Welt in die andere sollte sich für seine Geschichtsschreibung, in der die vergleichende Perspektive so prägnant ist, als ungemein nützlich erweisen.
Eric Hobsbawm bestand leicht (auch dank der guten britischen wie kontinentalen Gymnasialbildung) die Begabtenprüfung für die Zulassung zur Universität. 1936 nahm er am King’s College in Cambridge das Studium der Geschichte auf. Die Universität Cambridge sah ihre Aufgabe zumindest in den Geisteswissenschaften nicht darin, Fachgelehrte auszubilden, sondern die Mitglieder einer herrschenden Klasse zu formen, wie Hobsbawm ein um das andere Mal betonte. Die Professoren, die Dons, gehörten meistens zur liberalen Mitte, doch gab es, vor allem unter den Naturwissenschaftlern, auch eine starke linke „Fraktion“.
Den Zweiten Weltkrieg erlebte Hobsbawm in den rückwärtigen Diensten; so half er lange Zeit, Befestigungsanlagen gegen eine vermutete deutsche Invasion Englands anzulegen. Der in Deutschland und Österreich Aufgewachsene blieb trotz seines bald akzentfreien Englisch und trotz des britischen Passes den Dienststellen oft suspekt. Doch wurde er nach Kriegsende in Deutschland als britischer Armeeangehöriger eingesetzt, um gefangene Deutsche zu vernehmen – darunter seinen späteren Kollegen, den Bielefelder Sozialhistoriker Reinhart Koselleck. Er war in engem Kontakt mit Exilanten aus Mitteleuropa, von denen einige, wie der Dichter Erich Fried und besonders der Maler Georg Eisler, Sohn des Komponisten Hanns Eisler, seine Freunde wurden.
Nach dem Krieg begann Hobsbawms Weg als Historiker. Die ursprünglich geplante Arbeit zur Sozialgeschichte Französisch-Nordafrikas gab er bald zugunsten einer Forschungsarbeit über die Fabian Society und ihre Wirkungsgeschichte auf. Doch nach der 1950 in Cambridge erfolgten Promotion gestaltete sich die akademische Laufbahn zunächst schwierig. Grund war Hobsbawms Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei. Der Bruch Stalins mit Tito und die Vernichtung der Demokratie in Osteuropa konnten Hobsbawm nicht dazu bringen, die Partei zu verlassen. Er vermochte sich, und dies war typisch für das kommunistische Denken der Zeit, keinen gesellschaftlichen Fortschritt in Frontstellung zur Sowjetunion vorzustellen. So fand er zunächst keine und dann nur schlecht bezahlte Lehraufträge am King’s College in Cambridge und am Birkbeck College in London. Die letztgenannte Hochschule wurde schließlich jedoch sein dauerhaftes wissenschaftliches Heim. Bis es soweit war, verspürte er schmerzhaft den Ausschluss von Kommunisten aus der intellektuellen Gemeinschaft am eigenen Leib – gerade Linksliberale behaupteten nun immer wieder, ein Kommunist könne nichts anderes sein als ein Agent Moskaus.
Hobsbawms Arbeit als Historiker begann mit einer Quellensammlung zur Vorgeschichte der Labour Party ("Labour’s Turning Point", 1948) und seiner Dissertation über die Entstehung der Fabian Society ("Fabianism and the Fabians", 1950). Seinen Lebensunterhalt verdiente er zunächst – neben einer schlecht bezahlten Tutoren-Stelle – als Jazzkritiker. Unter dem Pseudonym Francis Newton (das er sich von Billie Holidays kommunistischen Trompeter Frank Newton ‚ausborgte’) schrieb er zahlreiche Kritiken vor allem für den New Statesman, von denen einige in seinen Büchern The Jazz Scene (1989) und Uncommon People. Resistance, Rebellion and Jazz (1998) gesammelt sind. Seine Bücher zum Sozialrebellentum ("Primitive Rebels", 1959, dt. 1962; "The Bandits", 1969) wuren gelobt. Es folgten Darstellungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung ("Labouring Men", 1964), zur industriellen Revolution ("Industry and Empire", 1968), aber später auch zur Wirkung der Französischen Revolution ("Echoes of the Marseillaise", 1990).
Nach Jahren der Ungewißheit hatte Hobsbawm jenes Glück, das ein Wissenschaftler in einer Außenseiterposition unbedingt braucht: Der Verleger George Weidenfeld beauftragte ihn Ende der fünfziger Jahre, einen Band über das Zeitalter der Revolutionen 1789 bis 1848 zu schreiben. Das Buch erschien 1962 im großen Publikumsverlag Weidenfeld & Nicholson und machte seinen Verfasser schlagartig bekannt, nach den Übersetzungen auch im Ausland. Endlich hatte er auch eine Festanstellung am Birkbeck College, aber Hobsbawm mußte 54 Jahre alt werden, bevor er den Titel eines Professors erhielt. Sein Leben war auch ein Beispiel dafür, wie ein Wissenschaftler seiner politischen Überzeugung treu bleibt und sich aus seiner beruflichen Bahn dennoch nicht hinausschleudern läßt. Zum Fleiß und Beharrungsvermögen trat freilich eine große Begabung als Forscher, Lehrer und Schriftsteller.
Blauäuig war Hobsbawm dabei nicht. Die Defizite in den sich sozialistisch nennenden Ländern nahm er durchaus wahr. Allerdings bedurfte es der moralischen Erschütterung durch Chruschtschows „Geheimrede“ auf dem 20. KPdSU-Parteitag im Februar 1956, um sich vom Kommunismus als säkularem Glauben zu lösen. Erst hier begann wirklich die Verwandlung des Eric Hobsbawm von einem, zugegebenermaßen denkendem Parteisoldaten, zu einem kritischen Marxisten. Doch im Unterschied zu E. P. Thompson, Christopher Hill, Ralph Miliband, Rodney Hilton oder John Saville blieb Hobsbawm KP-Mitglied. Die Mitgliedschaft in der Partei bedeutete aber nunmehr für ihn nicht mehr das, was sie seit 1933 bedeutet hatte. „In der Praxis mauserte ich mich von einem Parteisoldaten zu einem Sympathisanten, oder, anders ausgedrückt, von einem faktischen Mitglied der KP Großbritanniens im Geiste zu einem Mitglied der KP Italiens. Sie entsprach meiner Vorstellung von Kommunismus weit mehr.“[3] An anderer Stelle sagte er: „Dass ich nicht aus der KP austrat, hatte auch mit einem gewissen Stolz zu tun. Ich dachte: Wenn ich es zu etwas bringe, werde ich es trotz meiner Mitgliedschaft in der KP zu etwas bringen. Ich verteidige das nicht. Etwas anderes hingegen möchte ich verteidigen: Ich habe viele Leute gekannt, die ihr Leben für die kommunistische Sache aufs Spiel gesetzt haben.“[4] Darunter befanden sich vor allem italienische Resistenza-Kämpfer. Von den Ländern des sowjetischen Machtbereiches war Hobsbawm die DDR am vertrautesten, hier hatte er auch Freunde wie Jürgen Kuczynski, Fritz Klein und Siegfried Bünger, mit denen er fachlich und politisch zusammenarbeitete. Den DDR-Historiker Wolfgang Ruge kannte er seit seiner Jugend, als beide im KPD-nahen Sozialistischen Schülerbund aktiv waren.
In langen und überaus fruchtbaren Arbeitsjahren als Historiker, in zahlreichen Reisen insbesondere in die romanischen Länder wuchs Hobsbawm auch in deren Sprachen und Kulturen hinein. Internationale Aufmerksamkeit erlangte er besonders durch die meisterhafte Trilogie über die Welt des ‚langen’ 19. Jahrhunderts, die er unter formationstypischen und entwicklungsgeschichtlichen Aspekten als das von 1789 bis 1914 reichende Jahrhundert der bürgerlichen Revolution, des Kapitalismus und Imperialismus ansah. Die Bücher "The Age of Revolution 1789-1848" (1962), "The Age of Capital 1848-1875" (1975) und "The Age of Empire 1875-1914" (1987) wurden in zahlreiche Sprachen, darunter ins Deutsche, übersetzt.
Hobsbawms Buch "The Age of Extremes 1914-1991" (1994) aber gilt als sein bedeutendstes Werk. Es beginnt mit dem Ersten Weltkrieg und endet mit dem Untergang der UdSSR. Zahlreiche Rezensenten würdigten Hobsbawms Zusammenschau, in die nicht nur eine umfassende Quellen- , sondern auch eine ebensolche Weltkenntnis eingeflossen sei. Ungeachtet seiner scharfen Kritik an der Sowjetunion sah er in ihr ein Gegengewicht zu den USA, das die Reichen und bisherigen Weltbeherrscher aus Angst nötigte, die Bedürfnisse der Armen zur Kenntnis zu nehmen. Die teilweise Zerstörung des Sozialstaates nach 1991 war für Hobsbawm die hauptsächliche Wirkung des Entfalls dieser Angst. Seine Studenten in England und den USA forderte er immer wieder auf, den Marxismus kritisch zu studieren, um die Geschichte zu verstehen. Die marxistische Methode wie die Einsicht in die Brüche der Geschichte würden auch helfen, „die sich verdüsternden Aussichten, die das 21. Jahrhundert bietet, zu verstehen, … mit dem nötigen Schuss an Pessimismus.“[5] Das Studium des Marxismus könne Einsichten erzeugen oder sie vertiefen, führe aber nicht zu letzten Gewissheiten. Marx und Engels hätten, so Hobsbawm, gezeigt, dass angesichts der Expansion der Weltwirtschaft an Stelle der privaten Verfügung über die Produktionsmittel „eine gesellschaftliche Verfügung im Weltmaßstab“ treten müsse. Eine „post-kapitalistische“ Gesellschaft werde aber wohl mit allen traditionellen Modellen des Sozialismus kaum etwas zu tun haben. „Welche Formen sie annehmen und wieweit sie die humanistischen Wertvorstellungen des von Marx und Engels vertretenen Kommunismus verkörpern könnte, wäre abhängig von der politischen Aktion, die diesen Wandel herbeiführen würde.“ In diesem, und nur in diesem Sinn sei Rosa Luxemburgs Diktum „Sozialismus oder Barbarei“ noch immer gültig.[6]
Hobsbawms große Bedeutung als Sozialhistoriker lag und liegt in seiner gegenüber dem traditionellen Marxismus weitaus flexibleren Interpretation der geschichtlichen Wirklichkeit begründet. Er löste sich vom starren Klassenparadigma und von der überkommenen formationstheoretischen Sichtweise, wie sie seit der Zweiten Internationale das marxistische Gesellschaftsdenken dominierten. Es gelang ihm, andere als nur die bislang bekannten Formen gesellschaftlicher Auseinandersetzungen sichtbar zu machen. Im Typus des „Sozialrebellen“ sah Hobsbawm einen in der plebejischen Kultur verwurzelten, seine Klassenlage nicht notwendigerweise reflektierenden, die herrschenden Denk- und Ausbeutungsmechanismen dennoch herausfordernden historischen Akteur. Symbole und Riten, die „Erfindung von Traditionen“ und verschiedene Formen der Überwindung von Konventionen – all diese Fragen standen im Zentrum einer undogmatischen, dennoch dem Anliegen der Unterdrückten und Entrechteten immer verpflichteten Historiographie. Eric Hobsbawms Name bleibt mit einer kulturgeschichtlichen Spurensuche der Besiegten dauerhaft verbunden.
„Über achtzig Jahre lang im 20. Jahrhundert zu leben, war eine natürliche Lektion in der Veränderlichkeit von politischer Macht, von Imperien und Institutionen. Ich habe das völlige Verschwinden der europäischen Kolonialreiche gesehen, nicht zuletzt des größten von allen, des britischen Empires, das nie größer und mächtiger war als in meiner Kindheit, als es die Strategie einführte, in Regionen wie Kurdistan oder Afghanistan durch Bombenabwürfe für Ordnung zu sorgen. Ich habe gesehen, wie große Weltmächte in die unteren Ränge verwiesen wurden, und auch das Ende eines Deutschen Reiches, das tausend Jahre, und einer revolutionären Macht, die ewig währen sollte. Ich werde das Ende des ‚amerikanischen Jahrhunderts‘ wohl nicht mehr erleben, aber man kann ganz sicher sein, daß einige der Leser dieses Buches es erleben werden.“ Der Historiker solle jedoch nicht rein kontemplativ über das Werden und Vergehen sinnieren. „Soziale Ungerechtigkeit muss immer noch angeprangert und bekämpft werden. Von selbst wird die Welt nicht besser.“[7]