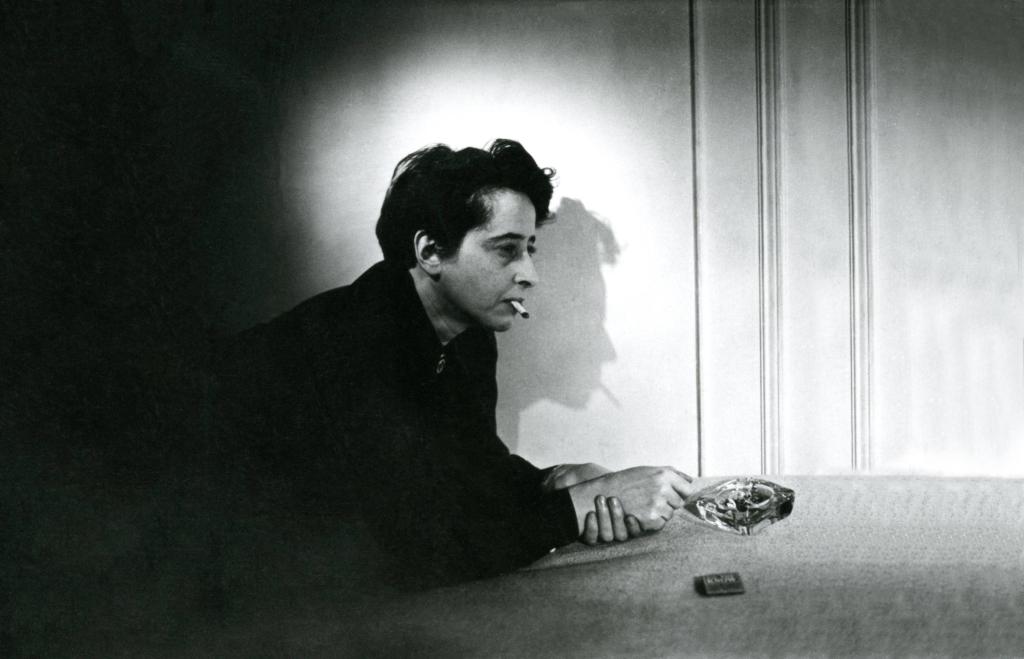Im Dezember 2025 ist Hannah Arendt seit fünfzig Jahren tot. Ihr intellektuelles Vermächtnis, das Interesse an ihren Schriften, die Arbeit an neuen Auflagen ihres Werkes, die Auseinandersetzung mit ihren Analysen, Beobachtungen und Einschätzungen könnten kaum lebendiger sein. Ein Vorzeichen dafür, dass die ohnehin rege Erinnerung an Arendt und ihr Werk sich in diesem Herbst und Winter noch einmal intensivieren wird, ist der nun in deutschen Kinos ausgestrahlte Dokumentarfilm Hannah Arendt. Denken ist gefährlich (2025) von Jeff Bieber und Chana Gazit. Der Film erzählt entlang der Chronologie von Arendts Lebenslauf die Geschichte ihres Denkens, Schreibens und politischen Handelns, und er zeigt eindringlich, dass diese drei Tätigkeiten für Arendt untrennbar miteinander verbunden waren.
Archivmaterial aus sieben Jahrzehnten
Ihre eindringliche Wirkung entwickelt die Dokumentation vor allem durch das Zusammenspiel aus historischen Filmaufnahmen, die ein Rechercheteam des deutschen Koproduzenten LOOKSfilm aus Museen, Staatsarchiven, Bibliotheken und Privatsammlungen zusammengetragen hat, und Aufnahmen von Arendt selbst, entweder in Form von Fotografien oder von Ausschnitten aus dem berühmten Gaus-Interview von 1964, das man in voller Länge auf YouTube oder in der ZDF-Mediathek sehen kann. Dieser Wechsel zwischen dem Fokus auf die Person, der ausdrucksstarken Gestik und Mimik Arendts, und den historischen Filmaufnahmen vermittelt einen lebhaften Eindruck der jeweiligen Lebenswelt, in der Arendt sich bewegte und an die sie sich im Gespräch mit Gaus erinnert.
Die Aufnahmen zeigen wuselnde Menschen in Königsberg, ernst entschlossene Studierende in Marburg, blasierte oder kecke Berliner*innen Ende der 1920er Jahre, Aufmärsche der Hitlerbewegung, Menschen, die Schilder mit antisemitischen Parolen umhertragen, die Wahlkampfspektakel Anfang der 1930er Jahre, den Reichstagsbrand, Polizisten, die infame Menschen verhaften, verzweifelte Ausreisende an Bahnhöfen, hektische Pariser Passant*innen ca. 1936, Frauen hinter Stacheldraht in den französischen Internierungslagern für ‚feindliche Ausländer‘, Schiffsreisende beim Passieren des New Yorker Hafens, fast verhungerte Menschen in Konzentrationslagern. Später folgen Aufzeichnungen von Verhören der McCarthy-Tribunale, Aufnahmen aus dem Gerichtssaal des Eichmann-Prozesses, Proteste gegen den Vietnamkrieg, Polizeigewalt gegen die Bürgerrechtsbewegung, die Erschießung Martin Luther Kings, Pentagon Papers, Watergate-Affäre, Nixons Abtritt etc. etc. Diese Aufzählung zeigt bereits: In den knapp eineinhalb Stunden des Filmes rauschen die Aufnahmen so schnell über die Leinwand, oft lässt sich nicht erfassen, was genau man gerade eigentlich sieht.
Immersives Erzählen
Für die Einordnung der Bilder sorgt keine auktoriale Erzählstimme, die das Sehen und Verstehen moderierend begleitet, sondern Kommentare von Wegbegleiter*innen Arendts und Expert*innen ihres Werkes: die Literaturwissenschaftlerinnen Barbara Hahn und Lyndsey Stonebridge, die Biograf*innen Samantha Hill und Thomas Meyer, Arendts Mitarbeiterin an der New School in New York, Elizabeth Minnich, Arendts Schüler und heute Präsident am Bard College, Leon Botstein, der Politikwissenschaftler Roger Berkowitz, die Schriftsteller*innen Kathleen B. Jones und Norman Podhoretz. Sie erklären, was Arendt jeweils erlebte und beobachtete, und wie sich das in ihr Schreiben übersetzte. Ihre Stimmen werden aus dem Off eingespielt, ihre Namen werden aber jeweils nur einmal genannt, meist wenn man sie zum ersten Mal hört (Untertitel gibt es nicht), der Dokumentarfilm verzichtet vollständig auf Studioaufnahmen der interviewten Personen. Manche von ihnen sind an ihren Stimmen wiederkennbar, mit der Zeit jedoch ist schwer auseinander zu halten, wer gerade spricht. Die Kommentare und Archivaufnahmen fließen ineinander über, der Film zieht hinein in Arendts Welten, er erzeugt Immersion und lässt wenige Verschnaufpausen.
Die Kommentare und Einordnungen wechseln sich ab mit Zitaten aus Arendts Texten, gelesen von Nina Hoss mit sachlicher Stimme, ohne zu versuchen, Arendt pointiertes Sprechen zu imitieren, was ein angenehmes Gegengewicht herstellt zu der mitunter dramatischen Filmmusik von Komponist Florian Tessloff – eine Dramatik, die Bilder, Kommentare und Zitate schon genügend vermittelt hätten: Dass die Dinge für Arendt und ihre Zeitgenoss*innen mehr als bewegend, ja oft bestürzend und lebensbedrohlich waren, das wird sehr deutlich. Den Film durchzieht, nicht zuletzt erzeugt durch den schnellen Wechsel der Archivaufnahmen und die atmosphärische Musik, eine bisweilen unterschwellige, doch stets wiedereinsetzende Stimmung der Unruhe und Bedrohlichkeit. Die Ereignisse scheinen sich permanent zu überschlagen, und Arendt Lebenswerk bestand vor allem darin, diesen Eindruck vermittelt der Film, mit den Ereignissen Schritt zu halten, ohne sich von ihnen mitreißen zu lassen, ihnen mit Verstand und klaren, unerschrockenen Urteilen zu begegnen.
Sich verlieben ist gefährlich
Es überrascht dann allerdings, wieviel Aufmerksamkeit die Dokumentation einer Beziehung in Arendts Leben schenkt, die erst nach ihrem Tod überhaupt bekannt wurde: das Verhältnis zu ihrem ersten akademischen Lehrer, Martin Heidegger, an dessen Seminaren sie als Philosophiestudentin in Marburg teilnahm und der für einige Jahre ihr Liebhaber war. Es sind diese Abschnitte des Filmes, in denen er in ein bizarres Schwärmen gerät. Fotografien der jungen, schönen Hannah, dazu Ausschnitte aus Hans Jonas Erinnerungen an die gemeinsame Studienzeit, an die bestechende Klugheit, den funkelnden Blick der Kommilitonin, sollen ihre unwiderstehliche Attraktivität herausstellen – Heidegger, so wird es suggeriert, konnte gar nicht anders, als ihr Avancen zu machen.
Dass Arendt ihn bald wieder verließ, wird noch erwähnt; dass sie die Universität wechselte, sich einen anderen Lehrer suchte, Karl Jaspers, mit dem sich eine lebenslange Freundschaft entwickeln sollte, in der Grenzen stets gewahrt wurden, das spielt hier keine Rolle. Stattdessen kommt der Film später auf Arendts Wiederbegegnung mit dem Ex-Nazi-Rektor im Nachkriegsdeutschland zu sprechen, erneut wird über die leidenschaftliche Liebesbeziehung spekuliert: Wie konnte sie ihm das nur verzeihen, erst die Loyalität zur Familie und dann der Beitritt zur NSDAP? Es muss, laut Kommentar aus dem Off, wahre Liebe gewesen sein, und in diesem Sinne triumphiere die Freundschaft und Intimität über die Politik. So oft diese Geschichte schon erzählt wurde, der völkische Professor und die kluge Jüdin, die die Katastrophe überlebte, und ihm verzieh, so sehr verfängt sie leider doch immer wieder.
Arendt und der Kommunismus
Ein anderer Aspekt, der wieder mehr mit Arendts Werk zu tun hat und der in diesem auf ihr Verhältnis zu Deutschland und die USA fokussierten Film fehlt, das ist die zentrale These aus der monumentalen politischen Studie, die Arendt Anfang der 1950er Jahre berühmt machte: die Grundidee von The Origins of Totalitarianism, dass der Totalitarismus kein nur deutsches Phänomen war, sondern sich ebenso in der Sowjetunion beobachten lasse. Der riskante Vergleich zwischen Nazismus und Stalinismus brachte Arendt, wie so oft, wenn sie Texte publizierte, nicht nur Anerkennung, sondern auch heftige Widerrede ein. Der Film erwähnt zwar, dass Arendt vor ihrer eigenen Flucht aus Berlin verfolgten Kommunist*innen Unterschlupf gewährte und dass ihr Ehemann Heinrich Blücher Marxist und Revolutionär war. Dass Blücher an der Entstehung des Buches über den Totalitarismus mitwirkte, dass Arendt dort und in anderen Schriften den Marxismus, Kommunismus und die sozialistische Revolution ebenso rigoros analysierte wie das NS-Regime, das lässt der Film spätestens dann vermissen, als es um die McCarthy-Jahre geht, die Arendt mit größter Sorge beobachtete und kommentierte. Über den Kommunismus in seiner politischen Gestalt, über (ehemalige) Kommunist*innen, die sich nicht offen gegen das sowjetische Regime abgrenzten, schrieb sie mit schonungsloser Kritik – die Kommunistenverfolgung, die sie in Deutschland und später in Amerika erlebte, lehnte sie entschieden ab.
Dieses spannungsreiche Verhältnis zwischen Kritik und politischer Ethik zu beleuchten, hätte zu den Wagnissen und Schwierigkeiten von Arendts Werk besser gepasst als manch eingängige Weisheiten, die in Form von verknappten Zitaten aus The Origins of Totalitarianism über das historische Filmmaterial gelegt werden. Wer den Arendt’schen Stil kennt, weiß um die oftmals langen Sätze und Gedanken, die trotz aller Chuzpe nicht immer auf Anhieb in ihrer ganzen analytischen Schärfe erfasst werden können und deshalb intensive Textlektüren erfordern. Gerade das macht Arendts Denken gefährlich: Dass es sich nicht darauf verlässt, was intuitiv verstanden wird oder unmittelbar einleuchtet.
The past is never dead
Der Anspruch des Filmes besteht allerdings nicht in der Vertiefung in die Ambivalenzen, Schwierigkeiten und komplizierteren Aspekte von Arendts Werk. Er möchte in erster Linie einen Überblick verschaffen und ihre Zeitgenossenschaft zur Geltung bringen. Dass sich damit der Wunsch verbindet, Arendt als Zeitgenossin auch der heutigen politischen Entwicklung in den USA lebendig zu halten, wird am Ende des Filmes deutlich, als Aufnahmen von den Feiern zum 200-jährigen Bestehen der USA, dem Independence Day 1976, übergehen in eine heutige Parade am 4. Juli. Festwägen, Marching Bands, Menschen, die mit US-Flaggen wedeln, im Hintergrund das Weiße Haus. Dazu liest Nina Hoss einen Ausschnitt aus dem kurz vor Arents Tod geschriebenen Essay „Zweihundert Jahre Amerikanische Revolution“:
„Eine der Entdeckungen totalitärer Regierungssysteme war die Methode, riesige Erdlöcher auszuheben, um darin unliebsame Tatsachen und Ereignisse zu vergraben […]. Ich halte es eher mit Faulkner, der sagt: ‚The past is never dead, it is not even past‘ – und zwar aus dem einfachen Grund, weil die Welt, in der wir leben, in jedem Augenblick auch die Welt der Vergangenheit ist; sie besteht aus den Zeugnissen und Überresten dessen, was Menschen im Guten wie im Schlechten getan haben […] es ist wahrhaftig so, dass uns die Vergangenheit heimsucht; es ist die Funktion der Vergangenheit, uns Lebende nicht loszulassen, die wir in der Welt, so wie ist, wirklich leben wollen“.[1]
Dazu erklingt melancholische Musik und es bleibt offen, welche Schlüsse aus diesem Zusammenspiel gezogen werden sollen: Dass die heute amtierende US-amerikanische Regierung daran arbeitet, die Republik in ein totales Herrschaftssystem zu überführen? Dass die USA in Gestalt der MAGA-Bewegung, der Beschwörung einer mythischen Vergangenheit, von den übelsten Kapiteln ihrer Vergangenheit heimgesucht wird? Dass die Menschen, die heute den Independence Day feiern, sich eigentlich auf der Abschiedsfeier für ein Amerika befinden, das verschwindet? Am Ende trauert der Film jedenfalls nicht allein um Arendt, die jene 200-Jahr-Feier nicht mehr erleben sollte, sondern auch und vor allem um ein Land in Transformation.
Zur Einstimmung auf einen Herbst und Winter, in dem sich viel an Arendt erinnert werden wird, und vor allem, um einen Eindruck von dem Konnex ihrer Lebenswelt und intellektuellen Arbeit zu erhalten, wie Arendt die jeweiligen Geschehnisse beobachtete und stets daran zu partizipieren versuchte, sei es durch Forschungsarbeiten, journalistisches und wissenschaftliches Schreiben, Hochschullehre, die Beteiligung an öffentlichen Debatten oder durch persönliches Engagement, ist der Film dennoch sehenswert.
Hannah Arendt. Denken ist gefährlich. Dokumentarfilm von Jeff Bieber & Chana Gazit. Buch: Jeff Bieber & Maia E. Harris. Produktion: Jeff Bieber Produductions, LOOKSfilm. D/USA 2025. 86 min.
[1] Hannah Arendt, „Zweihundert Jahre Amerikanische Revolution“, übers. v. Eike Geisel, in: Arendt, In der Gegenwart. Übungen im politischen Denken II, hrsg. v. Ursula Ludz, München 2000, S. 354–369: 364–365.
Zitation
Elena Stingl, Auf Besuch in Arendts Welten. Zum Dokumentarfilm Hannah Arendt. Denken ist gefährlich (2025), in: zeitgeschichte|online, , URL: https://www.zeitgeschichte-online.de/themen/auf-besuch-arendts-welten